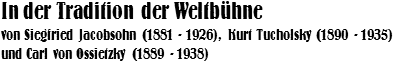Chemnitz war 2025 Kulturhauptstadt Europas und hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, vor allem auf kulturellem Gebiet. Da zu solchen Anlässen viel mehr Geld zur Verfügung steht, als es normalerweise der Fall ist, sind Extras möglich, die einer mittelgroßen Stadt und einem mittelgroßen Theater sonst verwehrt wären.
So war es möglich, dass die Oper Chemnitz einen Auftrag an Ludger Vollmer (Komposition) und Jenny Erpenbeck (Libretto) vergeben konnten, den Roman „Rummelplatz“ von Werner Bräuning für die Opernbühne zu adaptieren. Die sehr erfolgreiche Uraufführung wurde begleitet von einer Schreibwerkstatt [1] und einer Konferenz [2], die den Bogen von der Zeitgeschichte bis ins Kulturhauptstadtjahr 2025 schlug. Im Anschluss an ausgewählte Rummelplatz-Vorstellungen fanden gutbesuchte Publikumsgespräche innerhalb der Diskussionsreihe Gedankenkarussell [3] statt. Mit dieser intensiven Vor- und Nachbereitung durch das stimmige und informative Begleitprogram hat das Theater alles angeboten, was möglich war, die neue Rummelplatz-Oper zu kontextualisieren und zu unterstützen.
Eine Rezension dieser Opernproduktion ist im Blättchen schon erschienen (Ausgabe 18/2025 [4]). Ich erspare den Lesern also hier die Wiederholung des Inhalts und der Namen der Interpreten. Mein Interesse gilt der Musik dieser Oper und dem Romanautor Werner Bräunig.
Der 1961 in Berlin [5] geborene Ludger Vollmer, der an der Hochschule für Musik Leipzig [6] bei Dimitri Terzakis [7] studiert hat, schreibt über seine Musik im Programmheft: „Oper ist die umfassendste Kunstform, die wir Menschen hervorgebracht haben. Ihre Kraft zieht sie vor allem aus dem Gesang, der gesungenen Erzählung, bei der Worte, Inhalte, durch Musik machtvoll ‚geboostert‘ werden können.“
Der Autor des vorliegenden Beitrages erinnert sich gut an die großen theater- und musikwissenschaftlichen Konferenzen zu DDR-Zeiten, an Auseinandersetzungen und Verbandsdiskussionen, die vor allem von Gerd Rienäcker, Gerhart Müller, Frank Schneider und anderen bestimmt wurden, und bei denen wiederholt historisch wohlbegründete, intelligente und durchaus bis heute zutreffende Unterscheidungen zwischen „Musiktheater“ und „Oper“ herausgearbeitet wurden. Und welche Kraft und künstlerische Gestaltungshöhe hatten die Uraufführungen jener Zeit: Opern von Friedrich Goldmann, Siegfried Matthus, Udo Zimmermann …
Die Musik von Ludger Vollmer ist brillant instrumentiert, sie ist virtuos, frech, jazzig, auch schmissig, wo sie schmissig sein muss, auch schwelgend in deutscher Volkslied-Bierseligkeit. Aber eine Oper ist „Rummelplatz“ nicht. Denn die Musik funktioniert nicht nach den Regeln der Oper, sondern nach den Regeln des Films, also rein illustrativ: Eine Demonstration findet statt, es erklingt Marschmusik; ein Volksfest wird gefeiert, es erklingt liedhafter Chorgesang; Gefahr droht, es erklingt Spannungsmusik. Die ergreifenden Momente des Stückes werden durch traumschöne Video-Einspielungen (Stefan Bischoff), durch ein wandlungsfähiges, aber immer faszinierend düsteres Bühnenbild (Volker Thiele), vor allem aber durch den genialen Regieeinfall von Frank Hilbrich erzeugt, das Stück in Zeitlupe spielen zu lassen. Das verleiht dem Ganzen Schwere, Last und Bedrückung, weist aber den Handlungen der Protagonisten ikonische Bedeutung zu und kommt dem Romangeschehen sehr nahe.
Darüber hinaus muss auch das noch angemerkt werden: In dem von Jenny Erpenbeck hinzuerfundenen Epilog, in dem die Geschichte der Wismut nach der Wende sehr prosaisch und recht kunstlos zu Ende erzählt wird, ist die Musik beinahe komplett verstummt. Das kann natürlich Absicht sein. Auch Prokofjews Oper „Krieg und Frieden“ endet mit einer Sprechszene. Etwas unbefriedigend bleibt es hier wie da.
Trotzdem nahm das Chemnitzer Publikum diese schwierige und eher kunstferne Thematik des Uranbergbaus in der frühen DDR wirklich an – mit all den Russen, den Bonzen, dem Deputat-Schnaps für eine Mark und zwölf Pfennige und eben auch der Rummelplatz-Romantik mit all ihren Exzessen unter und auf dem Riesenrad. In den Publikumsgesprächen nach den Vorstellungen gab es heftige emotionale Diskussionen um diesen Themenkreis, Schilderungen von eigenen- oder Familienschicksalen. Es gab aber auch erhebliches bürgerschaftliches Interesse an den früheren Tabus, über die endlich zu reden die Gelegenheit war. Die Stadt war die Oper und die Oper war die Stadt: Der ewige Traum aller Kunst- und Kulturschaffenden vor, auf und hinter den Bühnen der Welt wurde kurz einmal wahr.
Der der Oper zugrundeliegende Roman „Rummelplatz“ ist eines der herausragendsten Werke der deutschen Nachkriegsliteratur. Er fasziniert durch seine distanzierte Lakonie und seine Erzählwucht. Die Geschichte dieses Romans, sein Verbot in der DDR und das Schicksal des Autors kann man nur als Tragödie lesen. Bräuning, durch das System und den Alkohol zerstört, starb 1976 in Halle. Franziska Augstein war sich 2007, bei Erscheinen des Buches, in der Süddeutschen Zeitung sicher, dass Bräunig, „hätte er weiter schreiben können, gleichrangig mit Autoren wie Günter Grass und Heinrich Böll gewürdigt worden wäre“.
Werner Bräunigs schuf ein von SED-Betonköpfen verbotenes, 1965 entnervt abgebrochenes und erst 2007 beim Aufbau Verlag postum erschienenes Riesenwerk von 700 Seiten (siehe Leseempfehlung). Die kulturpolitische Geschichte hinter dem Roman, die des Bitterfelder Weges als einer Annäherung von Künstlern und Staatslenkern, Disziplinierung und Entfremdung kann im vorliegenden Beitrag nicht erzählt werden. Aber es gibt ein gut recherchiertes Buch dazu (siehe Leseempfehlung).
Bräuning schlägt in seinem Roman den Bogen von den Anfängen der Uranförderung 1949 bis zum Arbeiteraufstand von 1953. In der Wismut, dem riesigen Abbaubetrieb, treffen vom Krieg gezeichnete Menschen aufeinander: der KZ-Insasse und der ehemalige Wehrmachtssoldat, der Sohn aus gutem Hause und der Glücksritter und alle zusammen treffen auf die sowjetische Schachtleitung und erleben, dass sie als die doch jetzt angeblich herrschende Klasse immerwährendem Druck ausgesetzt sind, Doppelschichten einlegen und ohne Sicherheitsvorkehrungen bohren müssen, damit die Fördermenge steigt. Zugleich steigt aber auch die Unfallgefahr. Besonders hart trifft die Malocher die ständige absurde Erhöhung der Arbeitsnormen. Hinzu kommt: Jede Störung im Betriebsablauf, jede fehlende Lieferungen von Ersatzteilen merken die Bergleute sofort in der Lohntüte, was die Stimmung fortwährend verschlechtert und auf den Aufstand 1953 hinsteuert.
„Es trifft wohl den modernen Zeitgeist, die bleierne Repression der Staatsorgane weit in den Vordergrund zu rücken gegen den Idealismus der Aufbauzeit, der dieser jungen DDR ja ebenso eingeprägt war – auch im Erzgebirge“, schreibt Christian Schmidt in der Neuen Presse.
Das ist wohl wahr. Aber in diesen Anfangszeiten liegen teilweise auch die Ursachen für allerlei Fehlentwicklungen, die das Ende mit herbeigeführt haben. Bei Bräunig liest sich das so: „eine Lehre, von der irrtümlich gesagt wird, sie sei vollkommen durchdacht, kommt leicht in den Geruch, dass sich weiteres Nachdenken erübrigt […] statt zu sagen: die Sache ist einigermaßen kompliziert und bedarf der Anstrengung, sagen wir viel zu oft: alles ist ganz einfach […] Weil nämlich alles vom zu Erreichenden lebt, und wer bleiben will, wo er gerade ist, sollte Reiseandenken machen, aber nicht Politik. Denn: Wenn wir nicht hoffen, wer soll es dann tun?“
Leseempfehlung:
Werner Bräunig: Rummelplatz, Aufbau Taschenbuch, Berlin 2008, 768 Seiten, 18,00 Euro.
Simon Barck / Stefanie Wahl (Hrsg.): Bitterfelder Nachlese. Ein Kulturpalast, seine Konferenzen und Wirkungen (mit unveröffentlichten Briefen von Werner Bräunig und Franz Fühmann), Karl Dietz Verlag, Berlin 2007, 200 Seiten, 14,90 Euro.