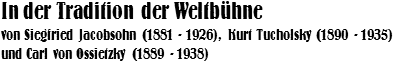Diesmal: „Katharina Thalbach liest Kästners Berlin“ – Berliner Ensemble / „Hannah Zabrisky tritt nicht auf“ – Schaubühne
***
BE: Radaunest-Leporello
Ein „Fußtritt Fortunas“ gab den letzten Anstoß: Für den Umzug aus Leipzig nach Berlin, 1927, im Beethoven-Jahr. Da reimte Erich Kästner: „Du meine neunte letzte Sinfonie! / Komm wie ein Cello zwischen meine Knie […]“ – Unverschämt, Frechheit, die Chefetage der Leipziger Neuen Zeitung tobte, Kästner verlor seinen Job als Redakteur und düste ab ins „Radaunest Berlin, den einzigen Ort Deutschlands, wo was los ist“.
Erste Unterkunft als möblierter Herr bei Frau Ratkowski, einer Witwe in der Prager Straße 17. Im August 1927, dicht am „Industriegebiet der Intelligenz“ rund um den Kudamm. Strategisch ideal für den Start in die Berliner Vorkriegs-Boheme. Für ein Start-up im Literaturbetrieb.
Kästners Vorsatz, da war er gerade 27: „Wenn ich 30 bin, soll man meinen Namen kennen. Bis 35 will ich anerkannt sein. Bis 40 ein bisschen berühmt. So ist mein Programm. Also muss es klappen.“
Es klappte sehr viel schneller: Mit 35 war der gebildete, wohlhabende Herr und notorische Frauenverführer längst berühmt. Als vielseitiger Feuilletonist für erste Blätter (Tageblatt, Berliner Illustrirte, Vossische, Weltbühne). Als Dramatiker, Schreiber von Bestsellern („Emil und die Detektive“, „Pünktchen und Anton“, „Fabian“), als Text-Genie fürs Kabarett und, natürlich immer wieder, Erfinder hintersinnig populärer Reimkunst („Es gibt nichts Gutes, / außer: man tut es.“).
Mit 35 war Erich Kästner aber auch ein verbrannter Autor (NS-Bücherfeuer 1933 auf dem Opernplatz). Ein zunehmend Verbotener, der sich mit anonym verfassten Texten für die Unterhaltungsindustrie durchschlug. „Man lässt die Heimat nicht fort“, schrieb er im Rückblick. Und bleibt – unter Bomben – seiner „Busenfreundin“ treu. Erst nach Kriegsende ging er fort. Nach München.
Ein Sachse in Berlin, der seine Stadt in seiner Zeit, ihr Schönes wie ihr Schrecklichstes, mit Beobachtungsgabe und Urteilskraft, mit tiefer Menschenkenntnis und politischer Klarsicht beschrieb. Kurz und bündig. Oder romanesk. Zusammen gesehen sind seine Arbeiten ein pralles, breit gefächertes Geschichten- und Geschichtsbuch. Ein packendes Sittengemälde. Da scheint im Vergangenen Heutiges auf. Und Immerwährendes. Allgemeinmenschliches.
Ein literarischer Schatz, den die Schauspielerin Katharina Thalbach mit aller Lust und aller Liebe hebt. – Kästner meinte gelegentlich, wolle man sein Schreiben sinnbildlich erfassen, ergäbe das „ein Gebinde wie aus Gänseblümchen, Orchideen, sauren Gurken, Schwertlilien, Makkaroni, Schnürsenkeln und Bleistiften“. Wir dürfen es an diesem Abend erleben; von Oliver Reese mit Präzision und Feingefühl eingerichtet, von Andreas Deinert kontrapunktiert mit Video-Montagen aus Archivmaterial.
Bestechend die Sprechkunst der Thalbach! Einem Kobold gleich, ganz in schwarz, hockt sie vor ihrem Tischlein mit Wasserkrug auf einem schönen, alten Holzdrehstuhl. So windet sie sich in die jeweils folgende der 27 stark unterschiedlich temperierten „Nummern“ dieses pittoresken Kästner-Leporellos. Ganz spielerisch. Das Gesagte oder via Video Gezeigte mit agilem Körpereinsatz kommentierend. In ihrer dunkel gurrenden Stimme blitzt mal galliger, mal herzensfroher Schalk, glüht Empathie. Schwingt aber auch Bitterkeit, Entsetzen, Schmerz.
Denn es stimmt nicht ganz mit Kästners lustigem Kontrastgebinde. Die kluge Textfassung von Sibylle Baschung macht eben nicht Halt vor dem auch von E. K. mit eindringlicher Nüchternheit beschriebenen Grauen, das die Stadt, das Land, die Welt zerstörerisch befiel.
Wie kunstvoll zusammengefügt sind da die Gegensätze: Das Harte, Sarkastische, das Zarte, Lakonische; das Witzige und Melancholische. Was für ein komödiantisches Thalbach-Theater! Was für eine Berlin-Show! Was für ein Erlebnis! Standing ovations.
*
Schaubühne: Panoptikum der Verstörten
Supergau im Theater: Der Star des Hauses, Hauptdarstellerin Hannah Zabrisky (Jule Böwe), eine Berühmtheit mittleren Alters, schmeißt hin. Inmitten der Voraufführung von „Langsamer Tod“, einem aufdringlich avancierten Stück übers Dahinwelken einer Diva mittleren Alters, alleinlebend, kinderlos, ausgebrannt. Doch solcherart Schmarrn findet Hannah, noch immer scharf aufs Feuer, peinlich, diskriminierend und schon gar nicht auch nur irgendwie relevant angesichts einer aus den Fugen geratenen Welt. Kleinkarierte Ichbezüglichkeiten, banale Psycho-Kunstkacke, derweil draußen „alles kaputt gemacht wird“. Hannah will einen anderen Text.
Doch erst mal macht sie den Flammenwerfer: Pfeift auf „Langsamer Tod“ und zieht vor Publikum eine höchst lebendige, radikal polit-aktivistische Impro-Show ab; aber auch das ist eigentlich platt (die böse Pointe). – Dennoch, das (fiktive) Publikum rast zwischen Bravo und Buh. Das Regieteam backstage hingegen verfällt in den nackten Wahnsinn. Doch Hannah Zabrisky in dunkelblau glitzernder Hollywood-Robe ist offensichtlich ganz bei sich selbst. Röhrt einen traurigen Popsong und zeigt allen den Stinkefinger.
So geht das Finale von Falk Richters Satire „Hannah Zabrisky tritt nicht auf“ über einen vehement zeitgeistig gespreizten, dabei vor Klischees nur so strotzenden Theaterbetrieb. Und über Altersdiskriminierung mit – Wow! – feministischem Schlussakkord. Doch bevor Schluss ist mit diesem Theater im Theater, wird in zwei kurzweiligen Stunden der flott bis ins absurde getriebene Probenalltag zelebriert. Es treten auf und vermengen sich alkoholgestützt mehr oder weniger intim: Ein in jeder Hinsicht impotenter Regisseur (Renato Schuch), seine unbefriedigte Liebhaberin (Ruth Rosenfeld), die hochmütige Dramatikerin (Alina Vimbai Strähler), ihr im Digitalen wie Realen erstaunlich bewandertes Liebchen (Pia Amofa Antwi) sowie Hannahs längst erkalteter, öde pragmatischer Ex und jetziger Bühnen-Partner als breitbeinig höhnender Lover (Kay Bartholomäus Schulze).
Bei allem Durcheinander im Irrgarten aus Bühne, Hinterbühne, Garderobe, Hotelschlafzimmer (Nina Wetzel) kommt es zu explosiven Wirrnissen um hilflos berufliche Anstrengungen der Theatermacher (Kunst) und deren schmerzlich private Befindlichkeiten (Leben). Da keimen Fragen, ob man noch spiele oder schon Ernst mache. Da wuchern Redeschlachten über zerschossene Hoffnungen, marktkonforme Selbstoptimierung, Rationalisierung der Gefühle, Freiheit und Konformität gegenüber angesagten Regeln. Über Blockaden aus Angst vor freier Rede – eben über all das, was da in korrekt genormter Sprache so durchs weltweite Netz geistert.
Ganze Wolken aus Blasen soziokulturell gängiger Diskurse ziehen eloquent arrangiert vorüber. Füttern Selbstgerechtigkeit oder stürzen die Beteiligten von einer (Sinn-)Krise in die andere – menschlich und künstlerisch. Alles in allem: Ein Tsunami allgemeiner Entfremdung. Ein sehnsüchtiges Geschrei nach Authentizität (oder Identität). Nach Glaube, Liebe, Hoffnung. Nach Wahrhaftigkeit.
So paradiert unter Regie des Autors ein Panoptikum der Unglücklichen und Verstörten. Lauter mittelmäßige Egoshooter, gemästet mit Wokeness, ringend um Coolness. Nur eine, die findet nach reichlich Whisky endlich ihren Widerstand. Es ist die unvergleichliche, bockig lebenskluge, rotzig zarte, unsere Herzen streichelnde und stechende Jule Böwe, die Falk Richters erschreckend unterhaltsame Farce groß macht.