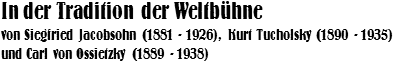Karl Wimmler hat im Blättchen 1/2026 [1] meinen Text „Hat der Pazifismus das Lager gewechselt?“ kritisiert, insbesondere die Verwendung des kantischen Satzes: „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“
Dieser Satz wird häufig zitiert, selten verstanden und fast immer aus seinem Kontext gelöst. Kant formulierte ihn nicht im luftleeren Raum moralischer Abstraktion, sondern als Intervention in eine konkrete politische Realität, geprägt von Revolutionen und Koalitionskriegen und einer Staatsräson, die Kriege beendete, um sie bald darauf erneut anzufachen.
„Zum ewigen Frieden“ richtet sich genau gegen diese Logik – gegen „friedliche“ Arrangements, die Kampfzonen einfrieren, Aggression belohnen oder Gewalt lediglich aufschieben. Solche Friedensschlüsse tragen den Vorbehalt des nächsten Krieges nicht zufällig, sondern strukturell in sich. Sie „Frieden“ zu nennen heißt, politische Täuschung zu institutionalisieren.
Der erste Präliminarartikel ist daher kein Urteil über schmerzhafte, asymmetrische oder unvollkommene Friedensschlüsse, sondern über solche, die in bad faith geschlossen werden: als Waffenruhen mit einkalkulierter Wiederaufnahme der Gewalt – diesmal nur unter günstigeren strategischen Bedingungen für den Aggressor. Kant moralisiert nicht. Er diagnostiziert. Frieden ist bei Kant keine Gesinnung, sondern die Institutionalisierung politischer Vernunft durch Recht und Vertrag.
Genau hier verfehlt die apologetische Verteidigung des „unvollkommenen Friedens“ ihren Gegenstand. Kant verlangt keine moralische Gerechtigkeit im emphatischen Sinn. Er verlangt jedoch, dass ein Friedensschluss zu politischen und völkerrechtlichen Veränderungen führte. Ein Arrangement, das lediglich das Recht des Stärkeren bestätigt, Eroberung nachträglich legitimiert oder den Aggressor strategisch besser stellt als vor dem Krieg, ist kein Frieden im kantischen Sinn. Es ist ein Waffenstillstand mit absehbarer Halbwertszeit.
Hier zeigt sich auch ein Unterschied zwischen der Aufklärung und unserer postheroischen Gegenwart. Die Vordenker der Aufklärung analysierten die Welt nüchtern, scharf und illusionslos – und hielten dennoch an Hoffnungen fest, allerdings um den Preis, die Konsequenzen dieser Analyse ernst zu nehmen. In den Jahrzehnten der sogenannten Friedensdividende verfuhren viele umgekehrt: Sie hielten an der Hoffnung fest und verzichteten auf die Analyse. Daher rührt das verbreitete Gefühl, man sei „in einer anderen Welt aufgewacht“. Tatsächlich leben wir spätestens seit dem 24. Februar 2022 nicht in einer anderen Welt, sondern in einer ohne Illusionen.
Der Einwand, es habe historisch nie einen „gerechten Frieden“ gegeben, verfehlt den Punkt. Kant argumentiert nicht historistisch, sondern normativ. Dass etwas nie erreicht wurde, sagt nichts darüber aus, ob es gefordert werden könnte – ja, gefordert werden müsste. Wer aus empirischer Ernüchterung die Norm absenkt, verabschiedet sich aus der praktischen Vernunft und landet bei bloßer Zweckmäßigkeit, die bekanntlich alle Mittel heiligt.
Auch historische Beispiele sogenannter „schlechter Friedensschlüsse“ sind ambivalent. Der Frieden von Brest-Litowsk etwa war für Russland demütigend, wurde aber nicht mit dem Gedanken der Vorbereitung eines neuen Krieges abgeschlossen. Er beendete das Massensterben an der Ostfront und widersprach Kant damit nicht. Zugleich untergrub er die politische Legitimität der bolschewistischen Regierung und trug so mittelbar zur Radikalisierung des russischen Bürgerkriegs bei, begünstigte Interventionen. Er ist kein Gegenbeweis gegen Kant, sondern ein Beispiel für die Tragik politischer Übergangssituationen. München 1938 hingegen schindete Zeit – und signalisierte dem Aggressor, dass Gewalt sich lohnt. Solche Friedensschlüsse widerlegen Kant nicht. Sie bestätigen seine Warnung. Wer daraus den Vorwurf des „ewigen Krieges“ ableitet, verwechselt Ursache und Wirkung.
Nicht der kantische Anspruch verlängert Kriege, sondern eine politische Praxis, die sich ihrer Verantwortung entzieht. Der „ewige Krieg“ ist nicht das Resultat überzogener moralischer Anforderungen, sondern einer systematischen Unterbietung politischer Schuldigkeit. Bei strikt missverstandener kantischer Anwendung ließe sich einwenden: Jede Kriegsbeendigung enthält Elemente von Kontingenz, Zwang und Machtasymmetrie; folglich sei jede darauf basierende Friedensregelung letztlich moralisch defizitär und damit kein legitimer Friede. Diese Lesart ist intuitiv, aber falsch. Sie verkennt Kants Anspruchsebene. Kant fordert keine moralische Perfektion, sondern unterscheidet klar zwischen dem, was rechtlich – und vielleicht auch moralisch – geboten wäre, und dem, was faktisch erreichbar ist.
Ein naiver Kantianismus führte tatsächlich in die Paralyse. Kant selbst verfällt ihr nicht, weil er Recht statt Tugend fordert, die Verallgemeinerbarkeit der Ordnung statt der Situation und Fortschritt asymptotisch denkt. Kant ist weder Pazifist noch Utopist: Er akzeptiert Zwang, Machtpolitik, ja sogar Krieg als politische Mittel. Er fordert jedoch, dass Frieden so verfasst sein sollte, dass er prinzipiell verallgemeinerbar sei – nicht faktisch gerecht für alle Beteiligten. Entscheidend ist daher nicht: Ist dieser Frieden vollkommen gerecht? Sondern: Enthält dieser Frieden Rechtsprinzipien, die konkret und allgemein gelten könnten?
Genau hier liegt der neuralgische Punkt der gegenwärtigen Ukraine-Debatte. Wimmler wirft mir vor, ich schlösse „verhängnisvoll“; meine Position laufe auf einen „ewigen Krieg“ hinaus. Trifft das zu? Wie und wann der Ukrainekrieg endet, weiß ich nicht; und ob es bald oder überhaupt zu Friedensverhandlungen kommt, desgleichen nicht. Jedoch sollte ein tragfähiger Friedensvertrag für die Ukraine mindestens drei Bedingungen erfüllen: Erstens einen verbindlichen Gewaltverzicht zur erst kurzfristigen, dann ausgedehnten Stabilisierung der Lage. Zweitens eine völkerrechtliche Legitimität als Grundlage einer nachhaltigen gesamteuropäische Sicherheits- und Friedensordnung. Und zwar unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen sowohl Russlands als auch der Ukraine. Und drittens politische Umsetzbarkeit – also Realismus statt Idealismus.
Der schwierigste Punkt wäre die territoriale Frage. Eine realpolitische Kompromissoption wäre ein Waffenstillstand entlang einer Kontaktlinie ohne endgültige Anerkennung ukrainischer Gebietsverluste. Das hieße – keine formelle Anerkennung russischer Annexionen bei gleichzeitiger Duldung faktischer Kontrolle, verbunden mit der aufgeschobenen Klärung des Status – etwa durch Referenden unter UN-Aufsicht nach mehreren Jahren.
Ebenso komplex wäre die Etablierung eines wirksamen Sicherheitsregimes für die Ukraine. Ohne ein solches wäre jeder Frieden prekär. Denkbar wären multilaterale Sicherheitsgarantien durch eine Gruppe von Staaten, die Stationierung internationaler Beobachter oder Friedenstruppen sowie klar definierte Reaktionsmechanismen bei Vertragsbruch. Ein bloßer Neutralitätsstatus ohne bindende Garantien wäre aus ukrainischer Sicht nicht hinnehmbar – die bisherigen Erfahrungen sprechen eine eindeutige Sprache.
Gewiss: Das ist nur ein denkbarer grober Rahmen. Doch worin unterschiede er sich grundsätzlich von Kants Maxime: „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden“?