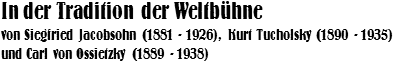Ein Artikel unter dieser Überschrift erschien im April 1796 im 11. Jahrgang des Journal[s] des Luxus und der Moden, basierend auf einem Beitrag des Rechtswissenschaftlers Johann August Reichardt im Rahmen eines Programmes des Dekanats der Jenaer Universität.
Einleitend hieß es, man bediene sich in der „Criminal-Justiz“ verschiedener Mittel, um flüchtigen oder unbekannten Verbrechern auf die Spur zu kommen. So versende man Steckbriefe, verfolge sie durch Miliz, führe Haussuchungen durch, signalisiere durch Glocken oder Schießgewehre ihre Flucht. Die Erfahrung lehre jedoch, dass man all diese Mittel oft umsonst anwende oder gar nicht nutzen könne.
Reichardt verwies in diesem Zusammenhang auf den Fall des jüdischen Kaufmanns Abraham Marcus Hekscher aus Hamburg, der am 1. Oktober 1795 in einem Leipziger Garten „am lichten Tage“ unter den Augen vieler Menschen „seiner Reichthümer beraubt und unmenschlich ermordet wurde“. Die Leipziger Polizei, „die in ganz Europa sich verehrungswürdig gemacht hat“, habe trotz aller Bemühungen zunächst keine Spur des Täters gefunden. [Am 9. Mai 1796 meldete die Königlich privilegirte Stettinische Zeitung, dass die Wäscherin des Erschlagenen die „Mordthat“ bekannt habe. Ihr Mann hatte Ringe des Ermordeten einer Galanteriehändlerin in Auerbachs Hof zum Kauf angeboten]. Notwendig sei, dass man bei zunehmender Schlauheit der Betrüger stärker über die Art und Weise ihrer Entdeckung nachsinnen müsse. Bisher habe man kaum darüber nachgedacht, wie man sich der Tiere zu jenem Endzweck bedienen könne. Diese hätten zwar weder Verstand noch Überlegung, überträfen jedoch die Menschen an „Gesicht, Gehör, Gefühl u. s. w.“. Sie könnten flüchtige Verbrecher fangen, gefangene bewachen, versteckte entdecken und bezwingen. Das alles sei bekannt und man habe sich hierzu der Hunde schon bedient.
Reichardt führte ein kurioses Beispiel an, das der Reiseschriftsteller Joseph de Blainville beschrieben hatte [1767 durch Johann Tobias Köhler im 5. Band „Zu des Herrn von Blainville Reisebeschreibung…“ in der Meyerschen Buchhandlung in Lemgo veröffentlicht]: König Carl V. habe in Montfaucon (Frankreich) am 8. Oktober 1317 einen Mörder mit dem Jagdhund des Erschlagenen kämpfen lassen. Als Gottesgericht sollte der Kampf zur Entdeckung der Wahrheit dienen. Der Mörder sei vom Hund an der Kehle gepackt worden und habe die Tat an seinem Freund gestanden, die „niemand gesehen habe als der Hund“.
Die Frage sei nun, ob Hunde wegen ihres scharfen und vortrefflichen Geruchssinns nicht geeignet wären, Missetäter auszuforschen. Bisher habe man es den Jägern überlassen, den Geruchssinn der Hunde zu nutzen, „ohne daraus einigen Nutzen für die gerichtlichen Untersuchungen zu erwarten“. Reichardt hielt es für wahrscheinlich, Hunde so weit zu bringen, sich ihrer „als Anführer zu Entdeckung und Einfangung unbekannt gebliebener Verbrecher leichter und geschwinder als sonst eines Mittels bedienen zu können“. Unbestritten sei, dass sich der Scharfsinn der Hunde nicht nur auf vierfüßige Tiere beschränke, sondern sich auch auf andere, leblose und lebendige Sachen, auf und unter der Erde erstrecke. Als Beispiel für „Menschen-Spürhunde“ verwies der Autor auf Schweizer Mönche, deren Hunde verirrte oder unter Lawinen begrabene Reisende durch Scharren anzeigen würden. Kein Problem sei es, bei einem Verbrechen auf freier Landstraße, in einem Wald oder an einem sonstigen wenig besuchten Ort die Spur des unbekannten Verursachers zu verfolgen. Schwieriger zu beantworten sei die Frage, ob Hunde durch ihren Geruch „einen Menschen von dem andern unterscheiden können“. Dabei müsse man zunächst zwischen bekannten und unbekannten Menschen „distinguiren“: Seinen Herrn erkenne jeder Hund auch nach langer Abwesenheit oder in fremder Kleidung. Ebenso würde ein Haushund eine fremde Person im Haus aufspüren. Angeblich würden Hunde Bettler mit einem „unversöhnlichen Hasse“ verfolgen, und, sofern man Naturforschern und Zeugen trauen könne, auch Diebe mit einem besonderen Instinkt „auswittern“ [Reichardt berief sich auf das 1563 von Conrad Forer ins Deutsche übersetzte „Thierbuch“ von Conrad Gesner]. Bereits Plinius der Ältere habe in der „Historia naturalis“ (um 79) versichert, dass nach dem Menschen kein Tier ein stärkeres Gedächtnis habe als Hunde. Würden also Hunde bei Zuchthäusern und Gefängnissen eingesetzt, hätten es die Gefangenen schwer, zu fliehen oder würden bald wieder ergriffen.
Könnte man Hunde soweit abrichten, auf Befehl des „Criminal-Richters“ Spuren eines fremden Menschen „auszuwittern“, ohne sich durch die Witterung anderer Menschen „irre machen“ zu lassen? Reichardt würde dies bejahen, solange er nicht durch gegenteilige Versuche widerlegt werde. Zum einen lehre die Jagd, dass ein Hund nie die Fährte verlasse, die er einmal aufgenommen habe. Zum anderen habe es Beispiele gegeben, dass sich Hunde „in Aufspürung ganz fremder Menschen, so gut als auf der Jagd nach Thieren“, als brauchbar erwiesen hätten. So glaubte man in Boveden nahe Göttingen einen Mörder entdeckt zu haben. Da man ihn nicht mit der Tortur belegte, gab es kein Geständnis. Man bat einen Jäger in der Nähe des Verbrechensortes um Hilfe. Der Jäger ließ seinen Hund das Blut des Ermordeten riechen, der Hund nahm die Spur auf und konnte auf dem Boden eines Hauses die blutbesudelte Kleidung des Mörders entdecken.
Reichardt holte sich bei den berühmtesten Jagdsachverständigen Rat, ehe er seine Auffassung über die Nutzung von Spürhunden zur Verbrecherjagd veröffentlichte: „Ihr Gutachten lautet durchgehends dahin, daß die Sache thunlich sey.“ Nur in einem Gutachten seien „Zweifel gemacht“ worden. So bestreite dessen Autor, dass Hunde ihnen unbekannte Menschen oder solche, die sie nicht lange oder nicht hinlänglich kennengelernt hätten, von anderen Menschen unterscheiden könnten. Der merkwürdigste Grund, den dieser Jagdverständige für seine Zweifel angab, war die „Bedeckung der Füße durch die Schuhe“. Aber: Selbst, wenn die Schuhe des Verbrechers oder etwa die Schalen des Rotwildes den Ausdünstungen, die in den Erdboden eindringen, etwas entziehen könnten, müsse man darauf vertrauen, dass die Hunde beim Wittern zugleich Wind und Luft auffangen würden. Deshalb spiele das mögliche Argument, Schuhe würden die Optik einer Spur verändern, für den Hund kaum eine Rolle.
Der Jagdsachverständige sei außerdem der Meinung gewesen, der Jagdhund verfolge nur deshalb die Spur eines angeschossenen Wildes, weil es Blut oder Schweiß auf dem Boden vergieße. Reichardt verwies entgegnend darauf, dass Verbrechen selten ohne starke Gemütsbewegungen verübt würden: Der eilfertige Übeltäter gerate durch körperliche Anstrengung, bei einer Schlägerei oder bei der Flucht schnell in Schweiß, was den Umständen bei der Jagd durchaus entspräche. Es sei also nicht unmöglich, dass ein an die Aufspürung von Menschen gewöhnter Hund die Spur eines solchen Täters leicht von anderen unterscheiden könne.
Reichardt gab zu, dass die Schärfe des Geruchssinnes der Hunde hin und wieder fehlschlagen könne. Das Wetter oder ein anderes Hindernis könne dafür verantwortlich sein, außerdem sei bei Tieren wie beim Menschen die Natur nicht durchgängig gleich. So gäbe es wachsame und unermüdliche Hunde, aber auch „Irrläufer und zwecklose Kläffer“, gesetztere und leichtsinnige, fleißige und faule Hunde. Allein nicht nur die Natur, sondern die besondere Zucht und Abrichtung brächten die gewünschten Gaben des Hundes zu Wege.
Reichardt habe zugleich betont, dass nicht der „Criminal-Spürhund“ über das Verbrechen entscheiden werde. Vielmehr solle er einen Verbrecher – ähnlich wie ein Gerichtsdiener – entdecken und „eine Anzeige darbieten“, deren Wahrheit oder Falschheit der Richter untersuchen könne.
Reichardt schlug vor, demjenigen, der zuerst einen Hund entsprechend abrichte, eine öffentliche Prämie auszusetzen. Zwar sei viel Arbeit mit dem Abrichten verbunden, aber ein Erfolg werden zur Wohlfahrt des ganzen menschlichen Geschlechtes beitragen.