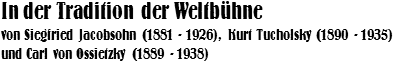In jenem Jahr 1913, in dem Tucholsky zur Schaubühne kommt, in dem das Blatt beginnt, politischer zu werden, führt Siegfried Jacobsohn eine neue Rubrik ein: die „Antworten“. Er hat diese kleine polemische Form nicht erfunden – andere Zeitungen hatten sie vor ihm, aber er hat sie meisterhaft beherrscht, die kämpferische Glosse, ironisch, pointiert, treffend, mit vernichtendem Witz, unerbittlicher Schärfe, großer Heiterkeit. Tucholsky war Mitarbeiter, Materiallieferant, auch Autor, doch die „Antworten“ waren das ureigene Produkt Jacobsohns – die Stimme des Herausgebers, die jede Woche das Heft beschloß.
Ernst Dr., Berlin. Darf ich auf Ihre Anfrage, ob die ,Schaubühne‘ wohl auch außerhalb Berlins gelesen werde, ein bißchen prahlen? Ja, sie wird es. Wie der Chinese Lotten und Werther mit ängstlicher Hand auf das Glas malte, so verfehlt er nicht, beim Zopfwickeln das gute Papier des Blattes zu benutzen, das Sie in der Hand haben. Australneger stehen gutural murmelnd zusammen und sind gegen mich und für Mossen. Tscherkessen sprengen in den Steppen Asiens umher und halten links den alles erjagenden Speer, rechts ein rotes Heftchen. Die Päschärähs tun es nicht unter einem Jahresabonnement. Und nur in Neu-Ruppin kommen wir nicht recht vorwärts.
(Die Schaubühne 20/1913, S. 556)
U. Sie fragen, warum hier fortwährend „hämisch“ glossiert wird, was Schmutziane der Presse von sich geben. Man sollte sie schon endlich lassen; es genüge doch, daß man hier anders sei. Es genügt nicht. Man kann nicht oft genug zeigen: Aus diesem Jauchefaß trinken Millionen und Millionen! das sind eure Quellen! das erquickt euch! das erhält euch! Es geht ein bekämpfenswertes Ruhebedürfnis durch diese flaue und maue Zeit: nur nicht absprechen, nur nicht immer rot ankreiden, sondern lieber „positive Arbeit“ leisten. Dieses Wort bedeutet: Alles vergessen, alles verleugnen, in den paar Momenten, wo es auf uns ankommt, ängstlich das Maul halten, weil alle schlafen wollen, und weil es bequem ist, wundervoll bequem. So slavisch sind wir noch nicht. Denn was die falschen Könige Ihren Thronen hält, das ist ja eben dies: das faule Schweigen.
(Die Schaubühne 30/31 – 1913, S. 751)
Konservative Zeitungen. Ihr habt euch doch sehr unanständig benommen, in diesen Tagen. Da hat der berliner Professor Anschütz in der Deutschen Juristenzeitung ein Gutachten über Zabern veröffentlicht – und merkwürdig: Ihr speit es an. Weil es nämlich mit erfreulicher Deutlichkeit feststellt, daß Gesetze verletzt worden sind. Ihr konstatiert, daß ein preußischer Rechtslehrer sein Fach nicht versteht – aber von euerm Verständnis habt ihr uns nichts abgegeben. Schon rauscht durch eure Spalten die Verwunderung, der die Denunziation zu folgen pflegt. Immer waren bei euch einzig die Gelehrten wohlgelitten, deren ernsthafte Studien ergeben hatten, daß, was ein Leutnant tat, in Wahrheit wohlgetan war. Es ist noch nicht politisiert, ihr Herren, wenn ein Professor der Ansicht ist, daß ihr ein Mal Unrecht habt. Er irrt? Gewiß: Ihr habt immer Unrecht.
(Die Schaubühne 1/1914, S. 26)
Ältester Abonnent. Du willst wissen, was ich mir selbst zum Beginn des zehnten Jahrgangs wünsche? In den Feiertagen habe ich Nietzsche gelesen und da diese Stelle, vom ersten Januar 1882, gefunden: „Heute erlaubt sich Jedermann, seinen Wunsch und liebsten Gedanken auszusprechen: nun, so will auch ich sagen, was ich mir heute von mir selber wünschte, und welcher Gedanke mir dieses Jahr zuerst über das Herz lief – welcher Gedanke mir Grund, Bürgschaft und Süßigkeit alles weitern Lebens sein soll! Ich will immer mehr lernen, das Nothwendige an den Dingen als das Schöne sehen: – so werde ich Einer von denen sein, welche die Dinge schön machen. Amor fati: das sei von nun an meine Liebe! Ich will keinen Krieg gegen das Häßliche führen. Ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger anklagen – wegsehen sei meine einzige Verneinung! Und, Alles in Allem und Großem: ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender sein!“ Irgendwann einmal will ich das auch sein. Aber ich fürchte, ich fürchte: es wird noch lange, lange dauern, bis ich so weit bin.
(Die Schaubühne 1/1914, S. 27)
Simplicissimus. Was ist denn das mit dir? Daß du überhaupt nachgelassen hast, ist deine und deiner Leser Sache. Daß du aber in einer höchst gefährlichen Zeit einen Herrn Krause auf den Thron steigen läßt, der Frankreich den Krieg erklärt, und daß du dann abbildest, wie die französischen Köpfe, Hände, Pferdebeine und Trommeln über Bluttümpel kollern: dies ist so ungeheuerlich, daß einen das andre Bild, wo die Zeppelins die englische Flotte vernichten, nicht weiter verwundert. Was ist das nur mit dir? Willst du mit aller Gewalt das Niveau der englischen Magazine erreichen, auf deren Bilderchen allmonatlich die deutsche Flotte in Cuxhaven geschlagen wird? Es ist nie an der Zeit, schlechte Witze zu machen; aber es ist jetzt ganz besonders nicht an der Zeit, aufreizende Geschmacklosigkeiten zu veröffentlichen, die von den üblichen chauvinistischer Observanz nicht mehr zu unterscheiden sind. Was ist das nur mit dir?
(Die Schaubühne 16/1914, S. 457)
Den Lesern. Es wird Euch nicht grämen, daß diese Nummer unpünktlich erscheint. Zusammengestellt war sie, als das Unheil in Zug geriet. Sie aber (bevor es an Druck und Expedition ging) erst einmal zu korrigieren und zu revidieren, war unter den veränderten Bedingungen der Kriegsläufte umso schwerer, als der Verkehr zwischen dem Festland und meiner Nordsee-Insel erheblich gestört ist. Wie sich auf dieser Insel zur Zeit die Welt ansieht, will ich das nächste Mal mit unbestimmtem Termin beschreiben. Was wird, weiß hier, und sicherlich auch anderswo kein Mensch. Wir würfeln wieder einmal um die größten Einsätze. Noch vor vier Wochen ahnte niemand, daß Rußland ein „Todfeind“ sei. Jetzt … Vor Jahren wars England, vorher und zwischendurch Frankreich. Wie‘s trifft. Aber wie‘s trifft: unsre Bücher und Theater und Philosophen und all das – können wir, glaub‘ ich, bis auf weiteres einmotten.
(Die Schaubühne 31/32 – 1914, S. 105)
H.M. „Haben Sie das bimörkt?“ fragt freundlich der Knockabout, nachdem er den andern mit einer riesenhaften Gartenspritze von oben bis Unten durchnäßt hat. Haben auch Sie „seit einem Jahr Leser der ‚Schaubühne‘“, endlich bemerkt, was ihr sogenanntes künstlerisches Programm ist? Ja, ich kann nicht leugnen, daß mein Herz weniger bei Ibsen als bei Strindberg, weniger bei Schiller als bei Kleist, weniger bei Wagner als bei Mozart ist. Ich überlasse Ihnen freudig, daraus die vorwurfsvollsten Schlüsse auf die Verworrenheit meines ästhetischen Geschmacks zu ziehen. Mit der Forderung dagegen, ich soll hier Ihrem Geschmack „Rechnung tragen“, werden Sie schon geringeres Glück haben. Denn, unter uns beiden: dies Blatt ist zu nichts anderm auf der Welt als dazu, die Überzeugungen des Herausgebers durchzusetzen. Er ist kaum beschränkt genug, um nicht die ,Wildente‘ zu lieben, für die ,Räuber‘ zu schwärmen und die ‚Meistersinger von Nürnberg‘ in einer guten Aufführung fast ebenso gern zu sehen wie ,Rigoletto‘. Aber er glaubt allerdings, daß die Schöpfer dieser Werke als Gesamterscheinungen der Vergangenheit angehören wie etwa Frankreich, während Strindberg, Kleist und Mozart trächtig und leuchtend von Zukunft sind wie Deutschland. Man solle glücklich sein, daß man sechs solche Kerle habe? „Hum“, sagte der Hauptmann Deveroux und rannte Wallenstein seinen Spieß in den Bauch. War der Endkampf zwischen Frankreich und Deutschland geschichtlich notwendig oder nicht? Genau so notwendig ist der Krieg zwischen jener Künstlertrias und dieser, oder richtiger: wider die eine und für die andre, weil die eine ihre Schuldigkeit getan hat und jetzt nur den Raum schmälert, den die andre braucht.
(Die Schaubühne 47/1914, S. 430)
v. G. Daß dies Blatt dazu da sei, um meine künstlerischen Überzeugungen durchzusetzen, war so töricht und pedantisch kaum gemeint. Nichts in belebender, als einmal, als öfter Aufsätze zu bringen, die meine Götter entgöttern, meine Schreckbilder verherrlichen. Kämpfen Sie für Wagner und wider Strindberg, tun Sie es aus zwingenden Gründen und mit blitzenden Waffen, und Sie werden mein gepanzertes Redakteursherz ohne Zweifel erobern. Deshalb ist es auch ganz falsch, von jeder Ansicht, die hier ausgesprochen wird, ohne weiteres vorauszusetzen, daß es meine Ansicht ist. Ich mache mir nichts aus Verhaeren und ahne garnicht, was Expressionismus ist: aber ich habe die Arbeiten von Bab und Huebner gedruckt, weil Männer, die ich schätze, ihre Anschauungen an dieser Stelle zu vertreten wünschten. Der Fall liegt doch sehr einfach. Entweder haben meine Überzeugungen die Zukunft für sich: dann wird kein abweichender Mitarbeiter ihren Weg hemmen. Oder nicht: dann wird es wenig nützen, daß ich … Sie wissen Bescheid und werden eine unwiderstehliche Verteidigung des ‚Wallenstein‘ verfassen.
(Die Schaubühne 49/1914, S. 478)
Musikkritiker des Hainburger Fremdenblattes. …Was ein wollender Mensch will, ist immer auf einen einzigen Satz zu bringen. Ich werde bis zu meinem hundertsechzigsten Jahre nichts andres wollen, nichts andres zu erreichen trachten, als daß die Deutschen sich vom ,Ring des Nibelungen‘ angewidert, von ,Figaros Hochzeit‘ beglückt fühlen. Das ist die Arbeit eines Lebens wert. Denn darin liegt, richtig verstanden, alles. Dort ist vereint, was wir in uns abtöten, hier, was wir in uns züchten und hegen müssen. Es geht mir wirklich nicht um den einen bestimmten Wagner. Er ist mir nur ein Sammelname für die hassenswürdigsten Begriffe: Krampf, Unklarheit, Großmannssucht, Unanmut, Brunst und Dunst, Lautheit, Breite, Kulisse, Treibhaus, Öde und Schwerfälligkeit. Drüben aber ist: Helligkeit, Grazie, Natur, Heiterkeit, Unschuld und Leidenschaft, Adel, Süße, Tiefe, Gefühl, Schwermut und Schwerelosigkeit. Wagner ist nicht bloß Wagner, sondern zugleich Hegel, d‘Annunzio, Lissauer, der Rembrandt-Deutsche, Bernini, der und jener Theosoph, und wer sonst mit Recht als keuchend, quallig, unreinlich und monströs empfunden wird. Mozart aber ist: Schopenhauer, Goethe, Friedrich der Große, Kleist, Busoni, Lessing, die Insel Sylt, Oscar Sauer, Hamsun, die Singakademie, Hanno Buddenbrook, Rembrandt, Lichtenberg, Liliencron und Bismarck, der auch nichts von Wagner wissen wollte …
(Die Schaubühne 6/1915, S. 143)
Königsberger. Sie teilen mir mit, daß die Königsberger Hartungsche Zeitung über mich schreibt: „Sein Selbstbewußtsein berührt nicht immer angenehm“, und die Königsberger Allgemeine Zeitung: „Mag manchem Leser die starke Betonung des Ich-Standpunktes, die Jacobsohn beliebt, nicht recht behaglich sein …“, und raten mir, in der besten Absicht, mich danach zu richten. Wenn den Vorwurf nicht auch, in der freundlichsten Form, Paul Block erhöbe, der zwar Ihr Landsmann, aber schon zu lange mein Stadtgenosse ist, um als der Dritte im Bunde meiner königsberger Mentoren bezeichnet werden zu können: so würde ich darauf erwidern daß der Kritiker in der Provinz, heiße sie Ostpreußen, heiße sie anders wie jung er immer sei, aus jener guten alten Zeit stammt, wo man eine heilige Scheu trug, mit seinem Ich überhaupt hervorzutreten, wo man erklärte, daß „wir uns gestern sehr gelangweilt haben“, und das nach Aufführungen, die nur den Kritiker gelangweilt hatten. Es gibt ja selbst heute noch viele Kaufleute, die um keinen Preis und keinen Verlust ein „ich“ aus der Schreibmaschine brächten. „Ihren werten Brief erhalten, bestätige ergebenst den geschätzten Auftrag und werde bemüht sein …“ Ein Fortschritt ist bereits die Wendung oder Inversion: „… und werde ich bemüht sein.“ Den Fortschritt, daß hier das Ich an die richtige Stelle gesetzt wird, werden wir nicht mehr erleben. Ich setze das Ich, mein Ich, an die richtige Stelle. Ich maße mir keinerlei Diktatur an. Ich sage, daß niemand weiter als ich der und der Meinung ist. Was Überhebung scheint, ist also eigentlich Bescheidenheit; zum mindesten kein Mangel an Bescheidenheit. Gegen den subjektiven Eindruck des Lesers steht der subjektive Eindruck des Schreibers, der vor dem Leser die Gabe voraus hat, seinen Eindruck zu deuten und darzustellen. Hat der Schreiber den Leser oft genug von der Gültigkeit seiner Einsichten und der Lauterkeit seiner Absichten überzeugt, so wird und wächst das, was man Autorität nennt. Wenn ich die in fünfzehn Jahren für eine Anzahl Leser gewonnen habe – ich glaube nicht, daß ich sie mißbrauche. Wenn ich öfter von mir spreche als abgeklärtere Kritiker, so entspringt das nicht einer Eitelkeit, die meinem Wesen fremd ist, sondern dem Wunsch, daß der Leser mich immer besser kennen lerne, daß er mich immer weniger als Pythia nehme, immer mehr als so und so beschaffenen Menschen, dessen Urteil und Geschmack aus einer ganz bestimmten Herkunft, Jugend, Bildung, Art und Unart zu erklären ist. Jedem steht dann frei, überraschende Abweichungen in der Bewertung einer Kunstleistung auf Besonderheiten des Kritikers zurückzuführen, die ihm entweder die Zustimmung oder die Ablehnung verwehren. Ein Kritiker, der diese Kontrolle nach seinen Kräften dem Leser ermöglicht, sollte meines Erachtens eher gelobt als getadelt werden.
(Die Schaubühne 4/1916, S. 96)
Leisetreter. Sie beklagen sich über den Ton meines Blattes? Da weiß ich Ihnen ein sicheres Mittel: befreien Sie mich von Ihrem Lesertum, und das schnellstens. Denn, unter uns: wenn Sie jetzt schon „peinlich berührt“ sind – es wird mit jeder Woche schlimmer. Jetzt nimmt man, freiwillig und leider auch unfreiwillig, noch Rücksichten. Aber sollte die Schweinerei je zu Ende sein, und sollte ich dieses Ende erleben, so wird hier ein Ton gepfiffen werden, ein Tönchen, daß euch Hören und Sehen vergeht, Es ist ein Wunder, daß wir an all dem Jammer jeder Art, den wir all diese Jahre stumm hinunterwürgen mußten, nicht unrettbar erstickt sind – und da verlangen Sie, daß eine Stunde länger, als unbedingt nötig, hinuntergewürgt wird? O nein, liebe Lise. Der Kessel ist überheizt, das Ventil ächzt und knirscht danach, geöffnet zu werden, und gibts keine vorzeitige Explosion, sondern bei rechtzeitiger Öffnung einen verhältnismäßig friedlichen Auspuff, so wird immer noch den empfindlichen Trommelfellen zu raten sein, sich in stillere Gegenden zu verfügen. Also, Leisetreter und deinesgleichen: befreit mich von euerm Lesertum!
(Die Weltbühne 44/1918, S. 424)
J. Die Obduktion der Leiche Karl Liebknechts ergab – der Presse stand davon nichts –: Gestorben an Idealismus und Tatkraft. In Deutschland ist das seit jeher tötlich. Man habe die eine oder den andern!
(Die Weltbühne 5/1919, S. 123)
Reichsbote. „Einem vielhundertstimmigen Ruf deiner Leser folgend, hast du „eine Geburtstagsadresse für Kaiser Wilhelm den Zweiten“ aufgelegt. Der alte Brauch wird nicht gebrochen: hier kommen die Deutschen angekrochen. Alle, welche nicht alle werden. Die berühmte deutsche Treue? Mit Treue hat das wenig zu tun. Ihr beweint ja keinen gefallenen Mann – wann jemals hättet Ihr einen Gefallenen beweint? – Ihr beweint die schöne Zeit, da ihr walten und treten konntet nach Herzenslust, und die, so Gott und der dumme deutsche Bürger wollen, gewißlich bald wiederkehren wird.
(Die Weltbühne 5/1919, S l)4\
F. Ludendorff sitzt im Adlon und liest Korrekturen – Rosa Luxemburg liegt auf dem Grunde des Landwehrkanals. In keinem andern Land der bewohnten Erde ist diese Rollenverteilung möglich.
(Die Weltbühne 15/1919, S. 396)
Liebknechts Mörder. Seid Ihr noch sämtlich da? Wie geht es denn mit der werten Gesundheit? Alles in bester Ordnung? Das ist recht. Bei den neuen Sicherheitsverhältnissen kann euch zum Glück nichts passieren. Gute Verrichtung das nächste Mal!
(Die Weltbühne 15/1919, S. 396)
Trübetümpler. Sie sollen abermals lachen. Da ist ein Buch erschienen, das heißt: ,Allvater oder Jehovah‘ und ist von ,Einem Verfluchten‘. Da steht im Vorwort: „Bezüglich der Rechtschreibung sind im allgemeinen die ‚Regeln‘ derselben als Grundlage genommen. Dieselben konnten aber dem Verfasser nicht in allen Fällen als vorbildlich erscheinen, da sich unter den sich ausarbeitenden Kommissionsmitgliedern überflüssigerweise auch jüdische Elemente befanden.“
(Die Weltbühne 45/1922, S. 510)
Kampfgenosse. Sie irren: ich bin schon im Anmarsch auf Berlin, teils, weil die Theaterleute den erstaunlichen Mut haben, selbst bei diesem Dollarstand eine Saison zu eröffnen, teils, weil die Justizbehörde mir mit Verhaftung gedroht hat, wenn ich nicht Sonnabend, am 29. September, vormittags 10 1/2 Uhr vor der 6. Strafkammer des Landgericht III in Berlin, Turm-Straße 91, Portal 4, III. Stock, Zimmer 574, Arm in Arm mit Joachim Ringelnatzen erschiene, um-fünf gelehrten Richtern auszureden, daß es ein fluchwürdiges Vergehen gegen § 184 des Strafgesetzbuchs war, die unshuldigen Leser der ,Weltbühne‘ durch die Benutzung des unzüchtigen Wortes „Beischlaf“ sexuell aufzuklären.
(Die Weltbühne 39/1923, S. 324)
Neugieriger. Sie wünschen einen Rückblick auf das deutsche Jahr 1923? Ich kann ihn ohne Worte liefern – indem ich einfach die Verkaufspreise der ,Weltbühne‘ aneinanderreihe. Nummer 1 und 2: 150 Mark; 3 und 4: 200; 6 und 7: 300; 8 und 9: 400; 10-13: 500; 14-17: 600; 18-21: 700; 22-24: 800; 25 und 26: 1000; 27 und 28: 1500; 29 und 30: 2000; 31: 3000; 32: 6000; 33: 13 000; 34: 45 000; 35: 100 000; 36: 200 000; 37: 500 000; 38: 1 500 000; 39: 4 000 000; 40: 7 000 000; 41: 20 000 000; 42: 70 000 000; 43: 300 000 000; 44: 4 000 000 000; 45: 10 000 000 000; 46: 60 000 000 000; 47 und 48: 300 000 000 000; 49-52: 350 000 000 000 Mark.
Auf das es uns übers Jahr besser gehe!
(Die Weltbühne 1/1924, S. 30)
M . Ihren Aufsatz kann ich leider nicht gebrauchen. Aber der Schlußsatz Ihres Begleitbriefs erklärt das deutsche Elend so schlagend, daß ich wenigstens ihn nicht ungedruckt lassen möchte: „Die Sozialdemokraten sind keine Marxisten und die Kommunisten Idioten.“
(Die Weltbühne 3/1925, S. 112)
(Auswahl: Heidemarie Hecht)
Die Weltbühne 36/1990