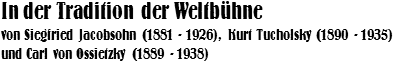Die Dankbarkeit ist die Tugend der Nachwelt.
Kuno Fischer
Die Stiftung Weimarer Klassik muss mit sehr viel Geld für die Zukunft fit gemacht werden, lautet ein allgemein gebräuchlicher medialer Slogan, gar nicht rücksichts- und stilvoll an die Sprachkultur der Weimarer Klassik erinnernd. Doch der verzweifelte Kampf deutscher Sprachkultur gegen die von vielen Zeitgeistern provozierten sprachlichen Absonderlichkeiten besitzt wahrlich eine lange Tradition.
Die ehrenvolle Klassik und der rüde Zeitgeist stritten auch in Weimar allezeit mit Ernst, Humor oder sogar Witz gegeneinander. Denken wir einmal an die Einweihung des berühmten Goethe- und Schiller-Archivs im Jahre 1897 zurück.
Damals stand das Deutsche Kaiserreich in voller Blüte. Majestät haderte zwar damit, dass das Reich bei der Aufteilung der kolonialen Welt zu kurz und zu spät gekommen war. Aber Goethe und Schiller waren noch immer ein starkes nationales Korsett für die imperiale Zukunft. Weimars Großherzog Carl Alexander war zutiefst davon überzeugt, dass das Reich um seiner Einheit und Kraft willen einen Goethe und Schiller mehr als je zuvor benötigte. Was nützten Krone, Rüstung und Marktwirtschaft, wenn die Nation nicht durch moralische und geistige Größe im Innern gefordert war?
Im Oktober 1897 feierte denn auch eine exklusiv verlesene Elite der Klassikfreunde vornehmlich aus dem deutschen Hochadel in Weimar das privat von der Großherzogin Sophie finanzierte neue Archivgebäude. Die Dame hatte das Geld aus der Abfindung abgezweigt, die sie von ihrer niederländischen Familie für den erzwungenen Verzicht auf die Königskrone erhalten hatte. Mit dem Mythos Weimar und dem gerade eröffneten Goethe- und-Schiller-Archiv wurde zugleich das gesamte Lebenswerk der inzwischen bereits verewigten Geldgeberin umschmeichelt.
Zum Festredner hatte man sich Kuno Fischer auserkoren. Mit der Wahl dieses Philosophen war die politische Hoffnung verbunden, in Weimar einen unwiderstehlichen Beweis erbringen zu können, wie eng ein Bündnis von Krone und Geist im Ringen um einen Platz an der Sonne sein konnte.
Ernst Kuno Berthold Fischer, geboren am 23. Juli 1824 im schlesischen Sandewalde, zählte damals zu den beliebtesten und darum unter Fachkollegen besonders umstrittenen und bekrittelten Philosophen deutscher Zunge. Die Printmedien reichten aus, Neid und Häme über den humorvollen Kuno in die Welt zu tragen. In seiner Weimarer Rede interpretierte Fischer Sophies Leben ganz brav als ein von Kindesbeinen an geradliniges Streben nach höchster geistiger Erfüllung im klassischen literarischen Erbe Weimars. Das ist in der menschlich komplizierten Königsfamilie Hollands mit ihren widersprüchlichen Charakteren selbst für die in sich gefestigte Sophie sicher ein grandioser Kraftakt gewesen! Sophie hatte tatsächlich mit dem Archiv und ihrem energischen Startschuss zur Goetheforschung sehr viel geleistet. Doch Fischer zielte bei der Legende von ihren individuellen Motivationen beträchtlich über die historischen Realitäten hinaus. Vielleicht wollte er auf diese Weise seinen Dank abstatten, dass er vierzehn Jahre als Professor für Philosophie in Jena wirken durfte. Traditionelle Ehrfurcht vor der Klassik durfte man dem Philosophen ohnehin unterstellen. Vielleicht lag jedoch auch ein versteckter Hintersinn in seiner devoten Apologetik. Es gab damals im deutschen akademischen Leben kaum einen Gelehrten, über den mehr Anekdoten im Umlauf waren als über Fischer. Die Wahrheit verlangt allerdings die These, dass die nervende „Exzellenz“ Fischer diese Anekdoten durch seine Eitelkeit selbst provozierte.
Der Philosoph Karl Jaspers (1883-1969), der Fischers Vorlesungen an der Heidelberger Universität noch selbst gehört hat, urteilte ernsthaft. Er schätzte dessen souveräne Rhetorik, sparte aber auch nicht mit Kritik an den demonstrativen Zugeständnissen an den wilhelminischen Zeitgeist: „Kuno Fischer […] vertrat die immer substanzloser werdende deutsche Bildungswelt, die sich gegen Realismus und Positivismus noch behauptete. Er identifizierte aber den Ernst der eigentlichen Philosophie mit der Gestalt, die sie in dieser Bildungswelt eingenommen hatte, und mit seinem persönlichen Anspruch, groß zu sein. Das gestattete man ihm und wehrte sich zugleich durch Erzählung jener Anekdoten, die doch bezeugten, dass er als eine überragende geistige Erscheinung galt und in seiner Weise auch war.“ Lieber Herr Jaspers, möchte man dem geschätzten Kollegen nachrufen, wenn Sie doch nur die Elogen heutiger Politikwissenschaftler hören könnten! Sie wären stolz auf Ihre Fähigkeit zu allgemeingültigen Bewertungen über mancherlei geisteswissenschaftliche Zünfte!
Seien wir gerecht. Kuno Fischer dachte und arbeitete in zahlreichen Kategorien. Er hinterließ nicht nur die große „Geschichte der neueren Philosophie“. Gerade dieses Werk beeindruckte auch Friedrich Nietzsche. Als Nietzsche 1882 gegen die von ihm so empfundene verknöcherte Gelehrsamkeit der akademischen Forschung seiner Zeit die „Fröhliche Wissenschaft“ schrieb, konnte er sich auf den 1871 erstmals veröffentlichen Essay Fischers „Über den Witz“ stützen.
Fischer liebte und beherrschte es, namentlich in Vorlesungen und Vorträgen, in präzis formulierender freier Rede, Arbeit und Spiel, Ernstes und Heiteres so kunstvoll miteinander zu verknüpfen, dass die Zuhörer wirklich und lebendig verstanden, was er sagen wollte. Fischer entwickelte „eine Genese der lachhaften Rede vom Galimathias, dem stilblütenhaften Versprecher, bis zur Satire, der höchsten Form des Witzes.“ Schrieb später einmal ein belesener Rezensent in der FAZ. Na, das wäre doch etwas für die moderne Marktwirtschaft! Daraus resultierte tatsächlich eine Popularität Fischers, der sich nicht einmal der große Psychoanalytiker Sigmund Freud entziehen konnte – natürlich distanziert und kühl analysierend wie Karl Jaspers. Freud zitierte Fischers Essay in seiner Schrift über den „Witz und seine Beziehung zum Unterbewusstsein“ ausführlich, wenn auch „etwas gelangweilt“, weil er die „disiectra membra“ – die Einzelteile eines philosophischen Systems lieber in einer ernsten Ordnung angesiedelt sehen wollte.
In der Weimarer Rede vom Oktober 1897 ist von dem geistvoll temperierten Humor Fischers allerdings nichts erkennbar. Er war sich der aristokratischen Würde der Stunde bewusst. Fischer zählte zu den ersten Mitgliedern der 1885 gegründeten Goethe-Gesellschaft und konnte sich darauf berufen, dass die beteiligten Institutionen und Gesellschaften den Beschluss zu dieser Veranstaltung bereits unmittelbar unter dem Eindruck des Todes Sophies im März 1897 in deren Sinn gefasst hatten.Das war Fischer dem großen Geist Weimars und seinem Kaiser schuldig: „Aus den Bezeichnungen jener Vorstände hiesiger Gesellschaften, Museen, Archive und Kunstanstalten leuchten uns die höchsten Namen der germanischen und deutschen Dichtkunst entgegen: Shakespeare, Goethe und Schiller, drei Namen, welche mit dem der Großherzogin Sophie von Sachsen in erinnerungsreichster Weise verknüpft sind.“ Er zitierte sogar die verblichene Sophie: „Diese ganze Idee ist hervorgegangen aus dem Gefühl der von mir übernommenen Verantwortlichkeit und der unbeschränkten Vollmacht, welche der letzte Goethe mir erteilt hat. Zu ihrer Ausführung denke ich mich an die ersten Kräfte Deutschlands zu wenden und bin eines freudigen Widerhalles sicher.“ Da konnte Fischer leider nicht mehr lange genug mittun. Am 5. Juli 1907 ist er in Heidelberg gestorben.
Doch eine Moral besitzt diese Geschichte: Ein halbes Jahrhundert nach Goethes Tod bedeutete die Möglichkeit des erstmaligen offenen Zugangs zu seinem Nachlass eine Zeitenwende in der Aneignung des geistigen Erbes der deutschen literarischen Klassik. Die Möglichkeit blieb nicht ungenutzt. Aber sie wurde, wie das in Deutschland so üblich ist, vom politischen Zeitgeist überlagert: Im Kaiserreich und fortfolgend bis zur marktkompatiblen freiheitlichen Demokratie.
Kuno Fischer als Wortgewaltiger des philosophischen Witzes? Bei allem Respekt vor seinen Kritikern – das ist doch nicht abwegig! Aber einseitig! Seinen Essay über den Witz hat er weise ausklingen lassen: „Der Humor duldet die vermeintliche Erhabenheit nicht und führt das menschliche Selbstgefühl von seiner eingebildeten Höhe wieder zurück in das richtige Geleis. Er hat den Witz nicht vertrieben, aber enttrohnt, der Witz ist nicht mehr Meister, sondern Geselle, den der Humor braucht, gern spielen läßt und selbst mit ihm spielt.“ Da konnten die Weimarer Zuhörer ganz unbesorgt sein.