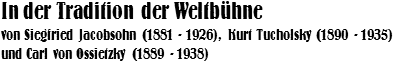Es ist nur natürlich, daß der entsetzliche Tod eines von den Faschisten Ermordeten zurückwirkt auf unser Bild von seiner ganzen Persönlichkeit. Zunächst ist da oft der Widerspruch zwischen der grauenhaften Gewaltsamkeit des Endes und dem gänzlich andersgearteten Lebens- und Denkstil des Betroffenen – man denke nur etwa an die feinsinnigen, wie mit den Fingerspitzen geschriebenen Literaturaufsätze eines Gustav Landauer und dann an seinen zu Tode getrampelten Körper im Gefängnis von Stadelheim. Der schmerzhafte Mangel an Beziehung zwischen einer Existenz und dem ihr bereiteten Ende verstärkt noch die Menschenwidrigkeit des Geschehenen. Man fragt nach dem Sinn, nach der Logik des Schicksals.
So war es auch bei Ossietzky. Die Entrückung eines so durch und durch vergeistigten Kulturmenschen in einen Bereich der gemeinsten Brutalität hat etwas vom Schock der Fotomontagen, in denen John Heartfield die Mißklänge einer verdorbenen Welt beschrieben hat. Und doch ist dies nur die eine Seite seines Schicksals; denn andrerseits ist es ja auch wahr, daß Ossietzkys gesamte Tätigkeit die Herausforderung einer Welt der ordinären Dummheit und verbohrten Gewalttätigkeit darstellte, die sich dann schließlich auf ihre Weise an ihm rächte. Diese Rache war die Bestätigung dessen, wovor er sein Leben lang gewarnt hatte.
Dabei können die Angeprangerten, die Zielscheiben seines vernichtenden Lächelns, alle die Generäle, die Richter, die Regierungsbürokraten, doch kaum verstanden haben, wovon er redete In groben Umrissen war ihnen wohl bewußt, daß er ihnen nicht gewogen, ja daß er ihnen gefährlich war. Im einzelnen jedoch war seine Sprache die einer Bildung, von der seine Widersacher wenig ahnten. Nicht nur war diese Sprache so voller aktueller Hinweise, daß, wenn wir seine Leitartikel heute wieder lesen, selbst uns, den Augenzeugen der damaligen Zeit, manche Anspielungen nicht mehr geläufig sind; sondern es wimmelte da auch von Zitaten, wie sie eben dem Erben einer jahrtausendealten Kultur mitgegeben sind – Zitate aus der Bibel, aus Shakespeare, aber auch aus Wilheim Busch. Sein Zorn, seine Entrüstung waren unverkennbar, doch war seine schärfste Waffe eine Ironie, mittels derer sich die Gewalthaber in die kümmerlichen Figuren einer bürgerlichen Komödie verwandelten. Es war da etwas von Moliere, von dem Ossietzky geschrieben hat, daß er „zwischen Schnörkeln des Kleides und der Seele Ewig-Menschliches entdeckte“ und sich dadurch eine dauernde Jugend sicherte, so daß „das helle Lachen und das verhaltene Weinen seiner Komödien noch heute gehört wird“.
Es scheint mir der Mühe wert, heute, wo sein Bild mit einem Trauerflor verhängt ist, daran zu erinnern, daß eben dieses helle Lachen, dieses verhaltene Weinen, die Stimmung war, in der wir damals unsere Arbeit taten. Man hat gefragt, was eigentlich unsere Absicht war und für wen wir schrieben. Dazu scheint es mir nötig zu bedenken, daß die Weimarer Republik ihrer historischen Aufgabe, aus den Trümmern der Monarchie einen demokratischen Staat zu erbauen, immer nur sehr stückweise gerecht wurde. Erstanden aus einer unerwarteten Revolution, mit einer Verantwortung betraut, deren die hastig ernannten Führer nicht gewachsen waren, gab es in dem buntscheckigen Staate nur eben diesen und jenen Einzelmenschen, dessen Intelligenz und Ehrsamkeit man respektieren konnte, aber dem Betrieb als ganzem standen Leute wie wir eben doch sehr kritisch gegenüber.
Man könnte uns vorwerfen, daß wir uns mit der bloßen Opposition begnügten und vor der weniger unterhaltsamen Aufgabe, an dem großen Bau tätig mitzuarbeiten, zurückwichen. Jedoch gab es zwar die Zukunftsvision einer zu erstrebenden Lebensform, nicht aber das architektonische Gefüge, in das wir uns hätten einschalten können, um die Vision zu verwirklichen. So war es denn die Idealvorstellung von Vernunft, Gerechtigkeit und Freiheit, an die wir uns hielten und für die wir in jeder Nummer zu unseren Waffen griffen. Das waren allerdings Begriffe, von denen in den täglichen Geschäften, in dem engen Bezirk der selbstsüchtigen Machtkämpfe, wenig die Rede war, und daher konnten wir in dies Spiel der praktischen Kräfte nur selten aktiv eingreifen. Wir wandten uns im wesentlichen an die wenigen Tausende gleichgesinnter und gleichgebildeter Leser, zu denen wir allwöchentlich von unserem Hügelchen herabstiegen, um die Gesetzestafeln wie ein Banner ermahnend zur Schau zu stellen.
Wie das im einzelnen vor sich ging, habe ich, in den Grenzen des Wenigen, das mir noch in der Erinnerung geblieben ist, anderswo beschrieben.[1] Ich hatte den Begründer der Weltbühne, Siegfried Jacobsohn, der meine ersten Arbeiten annahm, noch flüchtig gekannt, und Kurt Tucholsky, unser brillanter Hauptfechter, belieferte uns zwar laufend vom Auslande her, erschien aber immer nur gelegentlich ein paar Tage lang wie ein aufblitzender Komet in unserer Mitte. Man hat im nachhinein die Gegensätze zwischen ihm und Ossietzky zu dramatisieren versucht, und es versteht sich, daß bei zwei so völlig verschiedenen Temperamenten die Reibungen nicht ausblieben. Doch war es auch gerade diese Verschiedenheit, die zur Vielstimmigkeit des „Blättchens“ bereichernd beitrug.
Die Weltbühne war damals ein sehr bescheidenes Unternehmen. Wir bewohnten eine altmodische Bürgerwohnung in der Charlottenburger Kantstraße. In einem der Zimmer, von Papierstößen umhäuft, redigierte Ossietzky den politischen Teil, im Nebenzimmer war ich mit dem kulturellen Teil betraut. Dazu noch die unentbehrliche Treue unseres Faktotums, Hedwig Hünicke, und eine Sekretärin – das war alles. Ein formuliertes Programm hatten wir nicht, da wir ja keiner Partei oder Interessengruppe verschrieben waren. Der Kurs, den wir steuerten, ergab sich von Fall zu Fall aus der Haltung, die wir zu ihm einnahmen, und diese wieder entsprang aus den allgemeinen moralischen Grundsätzen, die uns als ungeschriebene Gesetze innewohnten.
Was bei aller Besorgnis um die Schicksale unserer Zeit unsre Arbeit bezeichnete, war das Vergnügen, das wir an ihr hatten. Wenn der Polemiker zum Satiriker wird, was ja bei Ossietzky so durchaus der Fall war, bleibt die Freude an dem gutgeschliffenen Floretthieb, das Kichern über die Schwächen des Nebenmenschen, nicht aus. Darüber hinaus aber bestimmte diesen erstaunlichen Mann eine tiefe Weisheit, die auch das Leid der Menschheit mit einem Lächeln milderte. Eines seiner Lieblingszitate hatte er dem Meister Ekkehard entnommen. „Die Wollust der Kreaturen“, sagte er gern, „ist gemenget mit Bitterkeit.“
Rudolf Arnheim war Redakteur des kulturellen Teils der Weltbühne unter Carl v. Ossietzky von 1928 bis 1933. Er ist emeritierter Professor der Kunstpsychologie, Harvard Universitär, und lebt in Ann Arbor, Michigan (USA). Sein Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem Mitte 1989 im Verlag der Weltbühne, v. Ossietzky & Co. erscheinenden Sammelband mit Exklusivbeiträgen namhafter Wissenschaftler, Schriftsteller, Publizisten und Künstler unter dem Titel „Nachdenken über Ossietzky“.
[1] – Siehe das Vorwort Rudolf Arnheims zu „Film als Kunst“, Hanser-Verlag München-Wien 1977 sowie sein Nachwort in dem von Ursula Madrasch-Groschopp in der Gustav Kiepenheuer Bücherei 1985 herausgegebenen Band „Zwischenrufe“. Beide Bücher sind im Buchhandel vergriffen, jedoch in Bibliotheken erhältlich.