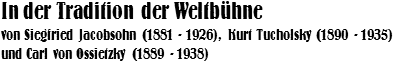Der dritte Mann (Kriegssüchtig)
Der Krieg war längst vorbei, aber in Gesprächen noch allgegenwärtig. Der Schichtzug von Halle nach Leuna ratterte, drei Arbeiter redeten vom Krieg, der unverzüglich ausbrechen würde, wenn Deutschland wieder „kriegstüchtig“ geworden sei. Man kam auf die Frage nach den besten Soldaten. „Damals warn die Deutschen die besten Soldaten“, begann einer. Der zweite sagte: „Ich denk, der Russe.“ Da nahm der dritte das Wort. „Die besten Soldaden, das warn mir Sachsen!“ Empörtes Gelächter entgegnete ihm. „Ausgerechnet! Haha!“ – Der Dritte blickte in die Runde und sagte bedächtig: „Ohne uns hätte der Hiddler den Krieg glattwegs gewonnen.“ – Der Zug hielt, die drei stiegen aus und gingen zur Schicht und der Zug ratterte weiter.
Gerhard Müller
Tucholsky, der Krieg und ein Museum
„Das moderne Schlachtfeld ist weder ein Feld der Ehre noch ein Feld der Unehre. Es ist die Abdeckerei der Kaufleute, wo Sadisten, Ruhmbesoffene, wertloses Gesindel und Unschuldige, Unschuldige, Unschuldige ermordet werden.“ Das Zitat las ich kürzlich bei einem Besuch im Rheinsberger Tucholsky-Museum. Die Sätze sind der Weltbühne vom 30. Juni 1925 entnommen. „Das geistige Niveau“ war der Titel des Beitrags, den Kurt Tucholsky unter seinem Pseudonym Ignaz Wrobel geschrieben hatte. Eines von vielen Zeugnissen in der Ausstellung, die Tucholsky als scharfen Gegner von Krieg und Nationalismus ausweisen.
Das Rheinsberger Museum sei in eine „Schieflage“ geraten, beklagten jetzt 13 Autorinnen und Autoren – Tucholsky-Preisträger oder ehemalige Rheinsberger Stadtschreiber – in einem gemeinsamen taz-Artikel. Wodurch? Die Stadtverordnetenversammlung des brandenburgischen Ortes hatte beschlossen, die Stelle des Museumsdirektors nicht mehr zu besetzen und das Museum stattdessen dem städtischen Amt für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung unterzuordnen, bei dem auch ein bekannter Rechtsextremer angestellt ist. Der Beschluss wurde Anfang dieses Jahres verwirklicht. Womit, wie die Kritiker befürchten, das Ende des Museums als eigenständige Forschungseinrichtung eingeläutet wurde. Die Akademie der Künste kündigte im Juli an, die Zusammenarbeit mit dem Tucholsky-Museum auszusetzen, weil „das Museum und die Sammlung ohne qualifizierte und wissenschaftliche Leitung nicht denselben Anspruch“ erfüllen könne, den es zuvor erfüllt habe. Die Autoren des taz-Artikels – Marion Brasch, Volker Braun, Konstantin Wecker, Max Collek und andere – wollen sich nicht damit abfinden, dass das Museum, unabhängig von der Qualifikation des Projektmanagers, nicht mehr eigenständig ist, sondern der Weisung des Tourismusamtes untersteht. Eine solche politische Kontrolle werde einem Autor wie Tucholsky nicht gerecht. „Daher fordern wir ein eigenständiges Museum statt eines Behördenanhangs sowie eine eigenständige Leitung statt eines weisungsgebundenen Projektmanagers. Und zwar nicht, weil Tucholsky unsere Unterstützung braucht. Sondern weil wir seine brauchen. Gerade jetzt. Gerade heute.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Achim Höger
Asyl bei Horkheimer
„Früher oder später wird das Asylrecht für politische Flüchtlinge in der Praxis abgeschafft. Es paßt nicht in die Gegenwart. (…) Das Asylrecht wird vor den gemeinsamen Interessen der internationalen Kapitalistenklasse verschwinden, soweit es sich nicht um Emigranten aus Rußland oder völkische Terroristen handelt. Hat ein Mensch aber die Hand gegen das Ungeheuer des Trustkapitals erhoben, so wird er in Zukunft keine Ruhe mehr finden vor den Krallen der Macht.“
Max Horkheimer: Dämmerung. Notizen aus Deutschland, in: Max Horkheimer, Gesammelte Schriften Band 2, Frankfurt 1987.
Trifonow zum Hundertsten
Juri Trifonow? Nie gehört. So werden wohl viele antworten. Im Osten sind hoffentlich noch einige Verehrer dieses großen sowjetischen Romanciers an meiner Seite.
Bei mir kam das so. Ich las seinen Roman „Der Alte“, in der DDR gerade erschienen, und war sofort von seiner knappen Erzählweise und von seinem tiefen Nachdenken über die grundlegenden Menschheitsfragen fasziniert: Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Wo liegt unsere Schuld in den Verwirrnissen und Irrungen der Geschichte?
Schnörkellos, ohne Metaphern, Abschweifungen und Verschlüsselungen erzählt Trifonow in dem Buch vom alten Revolutionär Pawel Jewgrafowitsch Letunow, den Stimmen aus der Zeit des Bürgerkriegs am stillen Don heimsuchen – wie aus Träumen. Und ihn bis in die Gegenwart immer wieder verfolgen.
„Geschichte wohnt jedem Tag von heute, jedem Menschenschicksal inne. Sie lagert sich in breiten, unsichtbaren – manchmal übrigens deutlich sichtbaren – Schichten in all dem ab, was die Gegenwart formiert“, sagte Trifonow einmal in einem Interview. Und in dem Roman „Der Alte“ legt er einer Figur in den Mund, „dass das Leben ein System ist, in dem alles auf rätselhafte Weise und nach einem höheren Plan ineinandergreift, nichts existiert abgetrennt, in Fetzen, alles zieht sich weiter und immer weiter, verflicht sich miteinander, ohne je ganz zu verschwinden“.
Ja, so ist es, und sein vielschichtiger Prosastil mit raffinierten Rückblenden auch in vielen seiner anderen Werke (beispielsweise „Ungeduld“ und „Das andere Leben“) hat vielleicht nicht nur mir geholfen, das Leben besser zu verstehen.
Trifonow selbst, am 28. August 1925 in Moskau geboren, hatte ein kurzes. Er starb daselbst an einer Lungenembolie mit nur 55 Jahren am 28. März 1981. Zu seinem hundertsten Geburtstag denken wir an ihn.
Frank-Rainer Schurich
Für S.K.
Unter dem roten Schirm der Sibylle,
Tief im Alt Wriezener Igelrevier,
Sucht nach dem Tag auch der Wind etwas Stille.
Mitten im Garten – der Sommer in Fülle –
Steht eine Scheune, das Bücherquartier.
Körnchen im Weltall, in luftiger Hülle
Atmen wir. Wege gehn hinter uns her.
Blüte wird Frucht und sich selber zu schwer.
Alles, was Antwort sucht, steigt aus dem Meer.
Befremdlich!
In ihrer Besprechung dieser Ausstellung, die mit „Surrealismen 1950–1990“ untertitelt ist, bringt Ingeborg Ruthe, Berliner Zeitung, den Kern der Malerei- und Literaturströmung des Surrealismus auf die treffliche Kurzformel: „Übernatürliches, das im Unbewussten schlummert, eine Über-Wirklichkeit, die traumhaft den Verstand verwirrt“. In der DDR galt Surrealismus als westlich, absurd, dekadent, ideologisch suspekt.
Da ist es für DDR-sozialisierte Besucher auf den ersten Blick schon strange, befremdlich, dass sie in „Strange!“ gleich reihenweise auf Maler der DDR treffen, die bis zum Zusammenbruch des ostdeutschen Staates dort gewirkt haben: Gudrun Brüne, Clemens Gröszer, Albert Ebert, Heidrun Hegewald, Wolfgang Mattheuer, Harald Metzkes, Wolfgang Peuker, Nuria Quevedo, Arno Rink … Selbst Volker Stelzmann hatte das Land erst 1988 verlassen.
Auf den zweiten Blick allerdings verflüchtigt sich das Befremden auf eine Weise, die Ingeborg Ruthe am Beispiel von Mattheuers Gemälde „Horizont“ folgendermaßen verdeutlicht: „‚Strange‘ bedeutet im Englischen: sonderbar, befremdlich, beklemmend. Und genauso hat der Leipziger Maler Wolfgang Mattheuer es gemeint, als er 1970 ‚Horizont‘ malte: eine Hügellandschaft mit Leuten, und am Hang eine aufgeschlagene Zeitung (das ‚Parteiorgan‘ Neues Deutschland) mit einem riesigen Ohr wie aus einem Dalí-Gemälde. Ein Mann, Typ Funktionär, hat sich durchs Papier gefressen und greift zum Roten Telefon – wohl um etwas, was nicht sein darf, zu melden. Ein zweiter neben ihm speit im Schlaf das Gedruckte seitwärts wieder aus.“
Überraschend auch die Wiederbegegnung mit Heidrun Hegewalds Gemälde „Kind und Eltern“ von 1976. Es wurde auf der VIII. Kunstausstellung der DDR in Dresden gezeigt und erregte landesweit die Gemüter: Ein bleiches Kind, ratlos in der geöffneten Tür stehend, blickt mit großen Augen in einen fast dunklen Raum. Unendlich weit entfernt und schemenhaft sitzen dort Vater und Mutter, den Rücken einander zugekehrt. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Über das Bild wurde seinerzeit, auch in den Medien, viel diskutiert. Von Surrealismus jedoch war dabei keine Rede, dafür umso mehr von einer Scheidungsquote in der DDR von bis zu 38 Prozent – damals der weltweit höchsten; gefragt wurde nach Ursachen, gesucht wurde nach Auswegen. Heutige westliche Betrachter hingegen, die den historischen Kontext nicht kennen, stehen vor dem Bild in – befremdender Ratlosigkeit. Das ist eine Emotion, die bei surrealistischen Sujets nicht die Ausnahme ist.
H.-P. G.
„Strange! Surrealismen 1950-1990“, Museum Scharf-Gerstenberg, Schlossstraße 70, Berlin-Charlottenburg; noch bis 16. November 2025; Mittwoch bis Sonntag, 11:00 bis 18:00 Uhr.
Milchspritzer
Man beurteilt Politiker gern auch aus landmannschaftlicher Sicht. Mein Freund in Hamburg, er heißt wirklich Jan Janssen, kann mit den Bayern nichts anfangen, denen ich als Sachse immerhin anrechne, dass sie keine Preußen sind.
Jan, obwohl historisch gebildet und überaus belesen, kann oder will die manchmal spinnerten bayerischen Herrscher unterschiedlicher Epochen nicht auseinanderhalten. Erst kürzlich meinte er, Ludwig II. habe nur Mütterrente und Raumfahrt im Sinn gehabt, Söder I. hingegen nur das Schloss Neuschwanstein.
Da sah ich mich veranlasst, den bayerischen Amts- und Bartträger zu verteidigen. Immerhin hatte er vor laufenden Kameras und eingestellten Mikrofonen keinen Geringeren als seinen Parteifreund Manfred Weber, den Europa-Abgeordneten und Vorsitzenden der EVP-Fraktion, sinngemäß gefragt, was für Unsinn man da in Brüssel anstelle.
Höchste Zeit, dass diese Frage gestellt wurde! Die undurchsichtigen Transaktionen der Kommissionspräsidentin in der Coronazeit erinnern fatal an die Liebhaberpreise, die der Gesundheitsminister einer Bananen(essenden)-Republik auf Kosten der Steuerzahler an Maskenhersteller in seiner engeren Heimat zahlte. Und ältere in Brüssel abgelegte Damen, deren Erfahrungen im Schützengraben offenbar jahrzehntelang zurückliegen, engagieren sich mit Schaum vor dem Mund für die Militarisierung ganz Europas.
Doch Jan Janssen wollte mich kontern. Söders Frage habe sich nur auf die idiotischen neuen Plastikverschlüsse bezogen, mit denen Brüssel den Kontinent überschüttet hat. Na und? Erst heute wieder habe ich wegen der unhandlichen und ökologisch wirkungslosen Erfindung mehrere Kubikmillimeter Milch in der Küche verspritzt. Markus Söder weiß also ganz genau, wo die dringlichsten Probleme von uns einfachen Europäern liegen.
Rainer Rönsch
Film ab
Mitten in der Nacht verschwinden in einer idyllischen Kleinstadt – einem der seit Jahrzehnten beliebtesten Handlungsrahmen US-amerikanischer Horrorfilme – bis auf einen alle Schüler einer Grundschulklasse (es sind 17 an der Zahl). Aufzeichnungen von Überwachungskameras offenbaren, dass dabei keine weiteren Personen involviert sind. Das folgende sowie das in Rückblenden sich erschließende Geschehen blättert Drehbuchverfasser und Regisseur Zach Cregger mittels des dramaturgischen Kunstgriffs auf, es nacheinander aus der Sicht von sechs der Hauptbeteiligten zu schildern. Es gelingt ihm dabei, eine Spannung zu erzeugen, wie sie der in besten Hitchcock-Filmen zumindest nahekommt.
Wem unter den Zuschauern es allerdings nicht gelingt, die Frage nach der Logik der Handlung völlig auszublenden, der könnte sich durchaus Benjamin Lees Kritik im Guardian anschließen: Die spannende Mysteryhandlung sei weitaus kitschiger und dümmer, als es zunächst erscheine; trotz einiger wunderbar erschütternder Schockmomente fehle es „Weapons“ doch insgesamt an Substanz und einem Element der Überraschung oder Raffinesse.
Nicht widersprochen werden soll auch David Rooney vom Hollywood Reporter: Der Film trage überall die Handschrift von Stephen King. Insbesondere Fans von Stanley Kubricks King-Verfilmung von „Shining“ und dessen ikonografischer Szene, als der von Jack Nicholson gespielte Wahnsinnige mit einer Axt eine Tür malträtiert, um seine dahinter verborgene Familie zu meucheln, kommen voll auf ihre Kosten: Cregger zitiert die Szene gleich mehrfach.
Wem allerdings Lebendiges zerfetzende Zombies auf den Magen schlagen, der sollte um „Weapons“ doch besser einen Bogen machen.
Und apropos Hitchcock: Der hatte bekanntlich die Marotte, in seinen Filmen – kurz und sehr beiläufig – selbst vor der Kamera zu erscheinen. Das hatte Cregger in seinem vorhergehenden Streifen „Barbarian“ auch getan. Er will das aber offenbar nicht zum Standard machen: Dieses Mal jedenfalls ist lediglich seine Hand zu sehen, die zu Beginn des Films eine Cola-Dose abstellt.
Clemens Fischer
„Weapons – Die Stunde des Verschwindens“, Regie und Drehbuch: Zach Cregger; derzeit in den Kinos.
Aus anderen Quellen
Christian Schweppe, Ciara Cesaro-Tadic und Tim Gorbauch interessierte die Frage, wofür und an wen die 100 Milliarden Euro Sonderschulden zur Aufrüstung der Bundeswehr geflossen sind respektive noch fließen, die der damalige Kanzler Olaf Scholz in seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar 2022 verkündet hatte. Zunächst musste das Trio feststellen, dass darüber eigentlich keiner der wesentlichen Beteiligten detailliert reden will. Trotzdem erfährt der Zuschauer in dieser ZDF-Dokumentation, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall mit 42 Milliarden Euro an Aufträgen den größten Schluck aus der Pulle abbekommen hat. Und am Ende des Films klärt Christian Mölling, früher DGAP, jetzt Bertelsmann Stiftung und einer „der renommiertesten Sicherheitsexperten Deutschlands“ (O-Ton Doku) darüber auf, dass die 100 Milliarden quasi nur die „Anschubfinanzierung“ seien: Bis 2040 rechnet Mölling mit 600 Milliarden. Wohlgemerkt – zusätzlich zum laufenden Rüstungshaushalt. Die fehlende Transparenz, so lässt sich Mölling allerdings entlocken, werfe natürlich Fragen auf wie: „Na ja, wenn ihr mit 100 Milliarden schon nicht ordentlich umgegangen seid, wie wollt ihr es dann denn jetzt mit 600 Milliarden machen?“
Christian Schweppe, Ciara Cesaro-Tadic, Tim Gorbauch: Die Zeitenwende-Deals, ZDF, 25.06.2025. Zum Video hier klicken. [1]
*
„Der russische Einmarsch in die Ukraine“, so Arno Gottschalk, „ist ein klarer Bruch von Art. 2 Nr. 4 der Charta der Vereinten Nationen, nämlich dem allgemeinen Gewaltverbot. Aber Sicherheitspolitik muss sich auch fragen: Was hat über Jahre dazu beigetragen, dass es überhaupt zu diesem Bruch kam? Wer diese Fragen tabuisiert, blockiert jede selbstkritische Strategieentwicklung – und läuft Gefahr, politische Fehler zu wiederholen.“
Arno Gottschalk: In der Tradition des Kalten Krieges, Berliner Zeitung [2], 01.08.2025. Zum Volltext hier klicken.
*
Vor 50 Jahren endete die „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ mit der Annahme der „Schlussakte von Helsinki“.
Aus diesem Anlass äußert Johannes Varwick: „Es ist bedrückend: Zum 50. Jahrestag der ‚Schlussakte von Helsinki‘ erleben wir eine Renaissance der Gewalt in den internationalen Beziehungen. Noch nie seit dem Ende des Kalten Krieges gab es so viele, so intensive und so andauernde bewaffnete Konflikte. Die Welt zerfällt in Machtblöcke – mit all den Risiken, die ein solcher Zustand mit sich bringt.“ Varwick plädiert dafür, den Geist von Helsinki wiederzubeleben.
Zu den Ursachen des heutigen Ost-West-Konflikts und auf die Frage, ob Russland auch nach dem Ende des ersten Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion vom Westen weiterhin als eigentlicher Gegner angesehen worden sei, meint Erhard Crome: „Ja, klar. Alle Versuche, das auf andere Füße zu stellen, wurden verhindert. Es gab Ideen in Moskau unter Jelzin, man könnte ja auch der EU beitreten oder der NATO. […] Das ist […] grundsätzlich abgelehnt worden, man wollte Russland in diesen Organisationen nicht haben. Es bleibt unter dem Strich, man hat Russland eigentlich immer als Gegner betrachtet – also unabhängig davon, was es tut. Diese Positionierung ist schon lange vor dem Überfall auf die Ukraine vorgenommen worden.“
Johannes Varwick: Geist von Helsinki wiederbeleben, Politisches Feuilleton, DLF, 01.08.2025. Zum Volltext hier klicken. [3]
Uwe Sattler: „Der Westen hat den Kalten Krieg gewonnen“ (Interview mit Erhard Crome), nd-aktuell.de, 31.07.2025. Zum Volltext hier klicken. [4]
*
Potsdam und das Land Brandenburg haben es hinbekommen, dass der 80. Jahrestag der Potsdamer Konferenz, auf der die Sowjetunion, die USA und Großbritannien als Hauptakteure der Anti-Hitler-Koalition vom 17. Juli bis 2. August 1945 Regelungen für den Umgang mit Deutschland und generell für die Nachkriegszeit trafen, ohne angemessenes Gedenken vorübergegangen ist. Doch Maritta Tkalec hat sich des Themas angenommen. Ihr Ausgangspunkt: „Waren Stalin, Truman und Churchill – also ,Die Großen Drei‘ (The Big Three), die vor 80 Jahren die Potsdamer Konferenz starteten und dabei eine neue Weltordnung aushandelten – intellektuell weiter als die heutigen Großmachtpräsidenten Putin, Trump und andere wichtige Akteure an den Verhandlungstischen?“
Maritta Tkalec: Lehrstunde stalinscher Verhandlungstaktik, Berliner Zeitung, 29.07.2025. Zum Volltext hier klicken. [5]
Zusammengetragen von Wolfgang Schwarz.
Letzte Meldung
Die sogenannte Frühstart-Rente ist ein geplantes staatliches Förderprogramm, das ab 1. Januar 2026 jungen Menschen einen finanziellen Frühstart in die Altersvorsorge ermöglichen soll. Es sieht vor, dass der Staat jedem Kind ab dem sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10,00 Euro in ein privates Altersvorsorgedepot einzahlt. Dieses Geld soll bis zum Renteneintritt steuerfrei angelegt und dann ausgezahlt werden.
Klingt nach – Super-Idee!
Cum grano salis: Selbst nach 60 Jahren, so hat der DGB berechnet, käme dabei bestenfalls eine Rente von 30,00 Euro pro Monat heraus. Klingt eher nach – Verar … e.
am