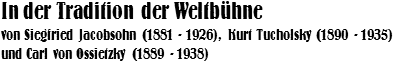Seit einiger Zeit geistert das Wort von einem „Produktivitäts-Rätsel“ durch Fachkreise und Medien. Allenthalben wird ein Rückgang des Produktivitätswachstums oder sogar des absoluten Niveaus der Produktivität (gemeint sind das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde oder die theoretisch umstrittene „Totale Faktorproduktivität“) registriert. Zwar wird in den hiesigen Medien meist von einer spezifisch deutschen Misere phantasiert, tatsächlich aber betrifft das Phänomen fast alle hochentwickelten Länder. Abgesehen davon, dass die empirisch gut belegte Tendenz natürlich erklärungsbedürftig ist, wird sie zu einem Rätsel oder einem Paradox vor allem dadurch, dass sie in einer Zeit raschen technischen Fortschritts stattfindet. Der Wachstumstheoretiker und Nobelpreisträger Robert M. Solow meinte einmal, man könne das Computer-Zeitalter überall beobachten, nur nicht in der Produktivitätsentwicklung.
Als dieses „Rätsel“ jüngst in diversen Veröffentlichungen auftauchte, wurde ich an das Ende der 1970er Jahre erinnert, als ich über Wachstumstheorien promovierte. Ich kramte die vergilbte Kopie eines Artikels hervor, den der bekannten Wachstumsforschers Edward F. Denison verfasst hatte. Titel: „Productivity Growth: A Puzzle“. Das Thema beherrschte damals die wissenschaftliche Diskussion und es erschienen zig Artikel und Bücher darüber. Und tatsächlich: Ab etwa der Krise von 1973 brach der Nachkriegstrend des Wachstums der Produktivität in allen Industrienationen ein und die Bundesrepublik war besonders betroffen. Zwischenzeitlich stiegen die Wachstumsraten zwar wieder, erreichten jedoch nicht mehr die Höhe der zwei, drei Nachkriegsjahrzehnte und sackten dann nach der Krise von 2007/2009 erneut ab.
Damals wie heute wird die Diskussion darüber immer dann angefacht, wenn Forderungen nach „mehr und intensiver arbeiten“ und eine Absenkung von Sozialleistungen begründet werden sollen. Um 1980 herum war die Produktivitäts-Debatte die Begleitmusik der neoliberalen Wende und heute gehört sie zu den Begründungsmustern für die neuerliche Regression des Sozialstaates. Deutschland bleibe – wie die stagnierende Produktivitätsentwicklung zeige – im internationalen Wettbewerb zurück und verliere an Standortqualität. Und dann kommt die übliche Litanei: zu hohe Löhne und Steuern, zu kurze Arbeitszeiten, zu viel Bürokratie …
Die empirischen Fakten sind unbestritten und werfen die Frage nach den Ursachen auf. Obwohl manche Messungen problematisch sind, kann das Phänomen nicht etwa als eine statistische Fiktion abgetan werden. Einige Bemerkungen dazu sind dennoch angebracht. Erstens muss auf den statistischen Basiseffekt hingewiesen werden. Wenn eine Größe einen konstanten absoluten Zuwachs aufweist, werden ihre Wachstumsraten aus rein mathematischen Gründen allmählich kleiner, weil der konstante Zuwachs zu einer immer größer werdenden Basis in Relation gesetzt wird. Nichts Dramatisches also. Zweitens waren die Wachstumsraten der Nachkriegsjahrzehnte, die oft zum Vergleich herangezogen werden, historisch einmalig hoch, weil der Wiederaufbau, die wirtschaftliche Rekonstruktion nach den Zerstörungen des Krieges mit besonders großen Anstrengungen – auch mittels öffentlicher Investitionen und in Westeuropa mithilfe des Marshallplans – vorangetrieben wurden und mit den Kriegsrückkehrern die Erwerbstätigenzahl überdurchschnittlich rasch anstieg. Und drittens sind die Wachstumsraten der Produktivität auch heute noch wesentlich höher als etwa im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Zeiten der industriellen und der elektrotechnischen Revolution. Auch aus dieser Sicht ist die gelegentlich anzutreffende Hysterie wegen des Wachstumsrückgangs unangebracht.
Erklärungsbedarf bleibt dennoch. Die Verlangsamung des Anstiegs setzte in den 1970er Jahren nicht nur im Zuge der Beendigung der Rekonstruktionsperiode ein, sondern auch im Zusammenhang mit anderen weltwirtschaftlichen Prozessen. Ab dieser Zeit begann der Anteil der Dienstleistungen an der Gesamtwirtschaft den der Industrie zu überholen. Es vollzog sich der Übergang von der „Industriegesellschaft“ zur „Dienstleistungsgesellschaft“. Dienstleistungen sind arbeitsintensiver als Industrieproduktion, die Produktivität der Arbeit also geringer als dort. Auch die Alterung der Bevölkerung erfordert Dienstleistungen und höhere Konsumausgaben; beispielsweise haben sich die Ausgaben für die soziale Pflegeversicherung in den vergangenen dreißig Jahren verzehnfacht. Der Strukturwandel zugunsten des Dienstleistungssektors drückt somit das Wachstumstempo der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität.
Ab 1973 trieb dann das OPEC-Kartell die Rohölpreise auf neue Höchststände; auch andere Rohstoffpreise erhöhten sich schlagartig. Mit einem Mal verteuerte sich die Produktion, was das Investitionstempo hemmte und damit auch denjenigen Prozess, über den neue Technologie in die Produktion eingeschleust wird. Diese Preisdynamik schwächte sich zwar in den 1980er bis 2000er Jahren ab, aber seit etwa zwanzig Jahren kommt es im Zuge der explodierenden Ressourcennachfrage der BRICS-Staaten sowie wegen der Covid-19-Pandemie und der Sanktionen gegen Russland erneut zu einer Beschleunigung. In jüngster Zeit stiegen auch die Produktionshemmnisse infolge von Lieferkettenproblemen. Weil die Schwächung des Produktionswachstums nicht mit einer gleich starken Dämpfung der Erwerbstätigkeit einhergeht, fällt das Produktivitätswachstum geringer aus. Für Deutschland schlugen in dieser Situation die Exportabhängigkeit und die Abhängigkeit von billigen Energieimporten aus Russland besonders stark zu Buche.
Zu diesen Faktoren kommt eine Veränderung in der Verwendung der eigentlich immer gestiegenen Gewinne. In einigen Analysen wird von einer „strukturellen Überakkumulation“ gesprochen: Die profitgetriebene Kapitalakkumulation trifft auf eine dauerhafte, überzyklisch gedämpfte und von schwacher Lohnentwicklung geprägten Inlandsnachfrage. Aber wohin mit dem überschüssigen Kapital? Finanzanlagen erweisen sich in dieser Situation als „Ausweg“ und sind zudem weit weniger riskant als Anlagen im Realbereich. Die sogenannte Finanzialisierung der Wirtschaft zeigt sich in einem überproportionalen Wachstum des Finanzsektors. Zugleich war die Globalisierung lange Zeit damit verbunden, dass der Kapitalexport in Schwellen- und Entwicklungsländer verstärkt wurde. Teils war dieser Prozess den günstigen Anlagebedingungen dort geschuldet, teils waren diese Investitionen notwendig, um die neuen Märkte zu erschließen. Im Gefolge des geringeren Investitionstempos hat sich der Modernitätsgrad des gesamtwirtschaftlichen Kapitalstocks (das Verhältnis der Netto- zum Bruttovermögen) seit Beginn der 1990er Jahre vor allem bei den Ausrüstungen in den meisten hochentwickelten Ländern, vor allem aber wiederum in Deutschland, stark vermindert und die Ausrüstungen sind infolgedessen im Durchschnitt älter geworden – kein guter Nährboden für höhere Produktivität.
Besonders beunruhigt zeigt sich die hiesige Wirtschaftselite davon, dass die Wettbewerbsposition Deutschlands geschwächt wird. In der Produktivität je Erwerbstätigenstunde wurde das Land in den vergangenen 15 Jahren vom achten auf den siebzehnten Platz weltweit abgedrängt. Wie zu sehen war, sind einige Ursachen des verlangsamten Produktivitätswachstums nicht beeinflussbar (selbst die aufstrebende, aber alternde Wirtschaft Chinas ist davon betroffen), andere hingegen schon. Die deutschen Industrievorstände betonen zwar immer ihre Innovationsfreudigkeit, haben aber bestimmte technologische Weichenstellungen – siehe Modellpolitik in der Autoindustrie oder Digitalisierungsrückstand – jahrelang vermieden. Als 2019 der damalige Wirtschaftsminister Altmaier eine staatliche Industriepolitik forderte, erntete er einen Shitstorm der sogenannten „Wirtschaft“. Staatliche Industriepolitik? Igittigitt! Da kündigte Joe Biden im US-Wahlkampf bereits ein öffentliches Innovations- und Investitionsprogramm an. Dass Trump das jetzt zurückdrehen will, ist ein anderes Thema.
Es sind Zweifel angebracht, ob die deutsche Regierung mit ihrem Infrastrukturprogramm und den diversen „Boostern“ die Zeichen der Zeit diesmal verstanden hat. Denn was auf der einen Seite mit den Händen aufgebaut wird, wird auf der anderen Seite mit dem Hintern wieder eingerissen. Rüstungsprogramme können zwar eine Zeitlang wirtschaftsfördernd wirken, aber letztlich wird produktives Potential brachgelegt, steht in Armeekasernen rum und wird – wenn nicht in Kriegen – dann auf Manövern verpulvert. Die produzierten Panzer und Geschütze mögen hochmodern sein, aber höhere volkswirtschaftliche Produktivität wird wohl doch eher durch moderne Maschinen und Investitionen in Bildung ermöglicht. Aber was macht das schon: Genau wie unproduktive Finanzanlagen wirft die Rüstungsproduktion trotzdem Profite ab: risikolos und staatlich garantiert.