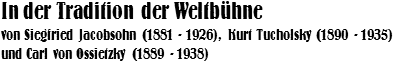Im Juli 1809 fuhr der 1772 in Weimar geborene Freiherr Fritz von Stein nach Königsberg. Einst hatte der geliebte Ziehsohn Goethes alle Vorzüge einer respektablen Karriere am Weimarer Musenhof ausgeschlagen. Unterstützt durch Goethe ging er 1795 in preußische Dienste nach Breslau und schlug dort fabelhaft ein: Regierungsrat und Direktor der Kunstakademie, das Landgut Strachwitz und die schnelle Einheirat in den schlesischen Adel prägten seinen Weg. Der Krieg Napoleons zerstörte das Glück. Das Gut wurde geplündert und zerstört. Stein schied unter französischer Besatzung aus dem Staatsdienst aus. Seine Frau starb und hinterließ ihm drei Kinder.
Steins Schicksal glich dem Preußens nach dem Vertrag von Tilsit im Jahre 1807. Der König und die Ministerien zogen sich nach Königsberg zurück, um die Reste des Staates zu organisieren, Kräfte für den Kampf gegen Napoleon zu sammeln und Preußen einer gründlichen Reform zu unterziehen. Der König hatte eine „Kombinierte Immediatskommission“ zur Ausarbeitung von Reformgesetzen berufen. Wenn Stein einen festen Platz in der preußischen Administration finden wollte, musste er nach Königsberg gehen!
Er hoffte auf hilfreiche Gespräche mit Ministern und höchsten Staatsbeamten. Primär setzte Stein seine Hoffnungen auf Wilhelm von Humboldt. Er war 1789 in Jena Zeuge gewesen, als seine Freundin Charlotte von Lengefeld, Schillers Ehefrau, erste Begegnungen zwischen Goethe und den Brüdern Alexander und Wilhelm von Humboldt arrangiert hatte. Inzwischen hatte sich eine tiefe und weitgehend krisenfreie Freundschaft zwischen Goethe und Wilhelm von Humboldt entwickelt, die auf gleicher Gesinnung, Gedankenvielfalt und ethischer Harmonie beruhte, obwohl der fast 20 Jahre jüngere Humboldt im preußischen Staatsdienst andere Wege als Goethe in Weimar ging. Der gebeutelte Fritz sah eine günstige Gelegenheit, Humboldt um Hilfe zu bitten. Der war bis 1808 preußischer Gesandter in Rom. Bei seiner Rückkehr berief ihn der König, die Leitung der „Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts“ im Justizministerium zu übernehmen. Diese Aufgabe führte ihn 1809 nach Königsberg.
Stein kam Anfang August 1809 in der Stadt des „Königsberger Jahrhunderts“ an. Bereits am ersten Tag kam Humboldt zu ihm. Stein fand ihn „lustig, zärtlich und keck“ und sie tauschten Begrüßungsfreundlichkeiten aus. Stein war optimistisch! Er gab sich in den folgenden Wochen redlichste Mühe, vielseitige Kontakte auf höchster und ministerieller Ebene zu knüpfen. Das Resultat war jedoch nicht nur nach den mehrfachen Treffen mit Humboldt ernüchternd. Überall wurde er freundlich empfangen, durfte an ministeriellen Beratungen teilnehmen und wurde mit lächelnder Unverbindlichkeit von einem gesellschaftlichen Höhepunkt zum anderen geleitet. So lernte er, dass die preußische Ministerialbürokratie im umstrittenen Prozess grundlegender Reformen, begleitet von Intrigen untereinander, keinerlei Interesse daran besaß, einen um Hilfe bittenden Landadligen aus der schlesischen Provinz in ihr Geflecht eindringen zu lassen. Für die Hohenzollern waren Goethe und das klassische Weimar ohnehin keine Empfehlung. Königin Louise zeigte sich vom Verhalten des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach als Mitglied des 1806 gegründeten Rheinbunds tief enttäuscht.
Fritz von Stein lebte in der Illusion, dass seine Treue zur preußischen Monarchie während der französischen Besetzung Schlesiens bis 1808 eine Empfehlung für den neuerlichen Staatsdienst war. Er klammerte sich an Humboldt und hoffte auf dessen Anhänglichkeit an Goethe, Schiller und Weimar. Humboldt verschwieg gegenüber Stein auch nicht, mit welchen sachlichen und persönlichen Problemen das Ringen um die Reformierung von Kultur und Bildung in Preußen verbunden war. Manche Anekdoten oder Witze begleiteten die Gespräche. Aber Stein konnte in seinem Tagebuch auch keinen Gedanken aufzeichnen, der darauf hindeutete, dass Humboldt ein praktisches Interesse daran besaß, ihn in seine Umgestaltungspläne einzubeziehen. Stattdessen schrieb Humboldt am 8. September 1809 an seine Frau: „Stein ist ein sehr guter Mensch, allein zur Arbeit doch nur sehr bedingter Weise tauglich. Was noch wunderbarer ist, so trägt er auch in diesen Unvollkommenheiten Spuren der Goetheschen Erziehung, die man nicht verkennen kann.“ Goethes pädagogische Mängel sah Humboldt so: „Ich glaube, dass es ihm geschadet hat, dass Goethe zu sehr mit ihm, wie er überhaupt leicht überall thut, auf das Reale und Praktische gehalten hat.“ Das von Goethe kommende Reale und Praktische sollte für einen preußischen Beamten nicht taugen? Es kam noch schlimmer! Humboldt drehte und krümmte sich, als wollte er notgedrungen über eine jahrelange negative Arbeitserfahrung mit Stein in der preußischen Reformbewegung urteilen, die nichts Gutes aussagte. Er hielt Stein für eine „kalte Natur“ ohne Rückgrat, Charakter und Entschlussfähigkeit. Das ging im preußischen Beamtenwesen natürlich gar nicht! Stein wolle sogar bei Humboldt bleiben, „weil es in meinen Sessionen viel vertraulicher und amüsanter zugeht“: Hier war Humboldt das preußische Hemd wirklich viel näher als der Weimarer Rock. Wenn da nur nicht Charlotte von Stein, Goethes liebste Freundin und Mutter des Quälgeistes gewesen wäre: „Da ich aber der Mutter sehr gut bin, werde ich doch sehen, ob er sich nicht auch vielleicht in einigen Stücken bessern und ziehen läßt. Denn kenntnislos ist er gar nicht.“ Humboldt musste Charlotte von Stein gar nicht erst bemühen. Seine kluge Frau Caroline reagierte am 11. Oktober kurz und bündig auf die Drehungen ihres Gemahls: „Was Du mir über den jungen Stein sagst, hat mich gewundert, ich glaubte, er wäre so eigentlich zum praktischen Leben gebildet und erzogen, dass das so recht seine Sache wäre. Sollte die gewisse Unbehilflichkeit, die Goethe offenbar in seinem äußeren Benehmen hat, mit seiner Erziehung übertragen sein?“ Doch Humboldt konnte oder wollte den geistvollen Rat seiner Frau nicht befolgen.
Schließlich nahm Stein all seinen Mut zusammen. Er ging direkt zum Innenminister Graf Dohna-Schlobitten „und bat, mich zum 1. Director vorzuschlagen, er lobte meinen Edelmuth“, ließ den Bittsteller jedoch abblitzen. Der ging am folgenden 17. November auch direkt und mit bangem Herzen zu Humboldt: „Ich klagte Humboldt Dohnas Inconsequenz. Er sprach von Dohnas Feigheit für den Augenblick sich mündlich zu erklären. Ich bemerkte bey Humboldt selbst nicht die günstige Meinung über mich, die ich voraussetzte zu finden. Er ist ein Mensch für die Welt.“ Er ist ein Mensch für die Welt bedeutete für Stein in diesem Augenblick: Ich bin ihm völlig egal!
Doch da gab es auch noch den Ministerialbeamten Georg Heinrich Ludwig Nicolovius. Das war ein überaus gebildeter und kulturvoller Mensch von großer Herzensgüte. Stein hatte zu ihm viel Vertrauen gewonnen. Nicolovius arbeitete unter Humboldts Leitung als Verantwortlicher für Kirchenfragen und Schulpolitik. Stein hätte gar zu gerne in diesem Bereich mitgewirkt. Als er scheinbar unverrichteter Dinge Königsberg verlassen hatte, war es Nicolovius, der ihm am 4. Januar 1810 einen Brief mit bemerkenswerter Offenheit über Humboldts Benehmen schrieb: „Daß Ihr geliebtes Schlesien Ihnen durch das übertragene Amt Vertrauen und Dankbarkeit zeigt, erfreut mich. Möchte der Staat bald ein Gleiches thun! Ihr Plätzchen in unserer Sektion ist noch ledig, und jetzt auch der Präsidentenstuhl, da der Chef (Humboldt) mit Besitznahme der reichen Erbschaft in Erfurt beschäftigt ist. Ob der reiche Mann sich mit diesem Stuhl werde genügen lassen, scheint mir oft zweifelhaft und macht mich besorgt.“
Stein war gerührt. Schlesien war tatsächlich wohl kalkuliert dankbar und würdigte ihn durch die Wahl zum Generallandschaftsrepräsentanten in der „Schlesischen Landschaft“, einer einflussreichen Kreditanstalt des Adels.
Stein trat wenige Jahre später auch an die Spitze der „Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur“, von der Goethe schrieb, dass ihm in Deutschland kein gemeinnütziger Verein bekannt sei, „wo mit solcher Ausdauer und mit solchem Erfolge so mannichfaltige Zwecke verfolgt würden“. Stein wusste, was sich gehörte. Er war auch nicht nachtragend. Es war ihm sogar eine Ehre: Er ließ Goethe und Humboldt zu reputierlichen Ehrenmitgliedern der Gesellschaft wählen.