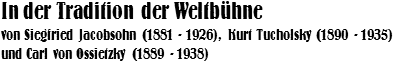Mitten im Arbeitstagebuch zum Labyrinth-Zyklus – Förster lebt förmlich in den Felshöhlen, -gängen und -schächten der Sächsischen Schweiz, die er in seinen Zeichnungen festhält, er fühlt sich hier Kräften ausgesetzt, die schwer zu beherrschen sind: Ausgeliefertsein und Nähe – erwähnt der Bildhauer am 2. Oktober 1974 einen neuen Stein:
„Gestürzter? Gefolteter? aus einem etwas größeren Findling der Sächsischen Schweiz angefangen. Die Steinarbeit ist erfrischend, ganz anders als die in Ton oder Gips: der Stein hat Herkunftsgestalt. Die unbegrenzten Möglichkeiten der Komposition entfallen und damit viele Zweifel: es kann immer nur nach innen, auf den Kern hingearbeitet werden“.
Erst zehn Tage später wird dieser Stein bezeichnet – es ist ein liegender Torso, ein Findling mit Vorbildung, der bewegtere Vorläufer des Kleist-Steins, der sich dann als Symbol aufrichten wird –, werden Schaffensprobleme benannt: „Sehr unzufrieden, weil keine Spannung entsteht. Der Stein hat noch zu viel Masse, aber es wäre töricht, zu früh gliedernde Details einzusetzen. Halte mich an die Geduld der frühen Griechen, an Maillol, der wusste, dass die Zeit, die man einer Plastik nimmt, von der Zeit (in der Zukunft) der Plastik genommen wird. Lese noch einmal den ganzen Kleist, den geliebten Kohlhaas, der mir sehr nahe Kafkas Schloss steht: Individuum und Macht. Ist die Vermutung falsch, dass beim Aufbau seiner Erzählungen Kleists militärische Schulung unbewusst fortwirkt? […] Sie beginnen, er braucht nur wenige Sätze, wie ein Offiziersrapport; Feststellung von Ort, Zeit, handelnden Personen – danach entfaltet sich die Erzählung …“.
Erst anderthalb Jahre später (am 17. April 1976) der nächste Kleist-Eintrag: „Gestern auf den Kleist-Stein Umrisse angelegt, ein Wagnis, ihn frei zu hauen“. Zweieinhalb Jahre später (am 14. März 1977) über die Arbeit am Stein bei Wind und Wetter: „Wärme die Eisen unter der Achsel an, damit ich sie überhaupt halten kann. Sturm fegt eisig über die Ebene, dringt durch Pelz und Wattehosen, er dörrt mich aus wie sengende Hitze“. Förster will den ‚natürlichen‘ Wuchs des Steins erhalten. Wodurch erhält er seinen stärksten Ausdruck? Nachts, er kann vor Ungewissheit nicht schlafen, geht er mit der Taschenlampe zum Kleist-Stein in seinem Atelier, „um Fehler zu finden, zu sehen, ob noch genug Stein da ist, Veränderungen möglich zu machen. Der angewinkelte Arm, die Maße der Hand. Zweifel Zweifel“. Abends, beim Spaziergang, stellt sich ihm Heinrich von Kleist selbst ein, wie in einer Geste von Brüderlichkeit, stumm geht er einen Schritt hinter ihm, in Richtung Wannsee, dann verlässt er ihn, ohne Gruß, denn er wird an einem der nächsten Abende wiederkommen. Am 21. März 1977 hat Förster dann das Gefühl, „am Kleist völlig versagt zu haben. Entschluss: ihn noch einmal scharf anzugehen, ohne Schonung des Vorhandenen“.
Es muss sich ein Grundgefühl für die jeweilige Arbeit einstellen. Der Bildhauer ist angehalten, etwas, das in sehr viele Elemente und Vorstellungen aufgesplittert ist, in ein geschlossenes Bild zusammenzufassen, die Summe allen Wissens zu einem Zeichen umzuwandeln. Das eben macht Kleist für Förster aus: Alles bis zur letzten Konsequenz voranzutreiben und nicht mit sich handeln zu lassen. Kleist ist ein Dichter, dem die „Mittellage“ fehlt, der die besänftigende Stimme nicht kennt oder anwendet, der an den Polen des Seins operiert, der alles fordert. Förster hat versucht, diese Widersprüche nicht aufzuheben, aber sie innerhalb der Skulptur so weit zusammenzuführen, dass diese nicht gänzlich zerrissen wird. Ihm ging es um das bedingungslose Aufstreben, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Würde, nach Wahrheit und Vertrauen. Und obwohl auch der Kleist-Stein weder Kleist noch eine seiner literarischen Figuren konterfeien soll, wenn eine geistige Analogie gefunden werden sollte, dann wäre es für ihn die zu Michael Kohlhaas. Ein Mann, dessen Träume und Hoffnungen ins Absolute zielen, der extrem, besessen, verwundet und verletzt ist, von Hellsichtigkeit und dunkelster Ahnung getrieben, von Glut, Leidenschaft und Kälte gleichermaßen verbrannt. Kleist ist nicht der Dichter, der den Stachel aus unserem Fleische gezogen hätte, sagt Förster.
Den tektonischen Würdeformen von Pfahl und Stele, die er sonst zu einem Höchstmaß an Strenge und Hoheit verdichtete, so etwa seine „Große Neeberger Figur“ (1971-76), hat Förster im Kleist-Stein eine flammende, zuckende, auffahrende Form entgegengesetzt. Er hat die signalisierenden Möglichkeiten der Gliedmaßen in das Zentrum seiner Arbeit gestellt. Das beginnt mit einer unbeirrbaren, fast aggressiven Aufwärtsbewegung, die durch organisch ungleichmäßige Aufwellungen und Einziehungen eine atmende Lebendigkeit erhält, und steigert sich in der heftigen, leidenschaftlichen Gebärde am oberen Ende. Der emporgereckte Oberarm winkelt sich im Ellenbogen zum abbrechenden Stumpf, die Hand hinterfängt den Kopf, zu einer dramatischen Leibhaftigkeit des Steins, die ihresgleichen sucht. In Verzweiflung auf das Ich zurückweisend. Das Figürliche wird mit neuer plastischer Zeichenkraft versehen, zum Denk-Zeichen, zum Symbol der schöpferischen Potenz schlechthin, dem aber kein Tun, keine ausgreifende Entfaltung möglich ist.
Förster ist ein Bildhauer der physiognomischen Gebärde. Darin scheint ein Widerspruch zu stecken, denn Gebärden werden von unseren Gliedmaßen vollbracht, die physiognomischen Kräfte sind dagegen auf das menschliche Antlitz beschränkt. Förster aber führt, was sich gegenseitig auszuschließen scheint, zu einer Gestalt zusammen, zu einem Ganzen, das größer ist als seine Teile, das mächtiger wirkt als seine anatomischen Bestandteile. Er schmilzt auf und verdichtet. Er erfindet Verzahnungen und Verschränkungen, Formen, die einander verschlingen, die sich verkrallen, die überlappen und überquellen. So wird der Schädel mit dem eben nur angedeuteten Antlitz zur lodernden Landschaft, diese zur urtümlichen grimassierenden Verzweiflung. Eine jähe Schnittfläche, schräg durch den Arm und Schädel geschlagen, beendet abrupt, wie der tödliche Schuss am Wannsee, die Figur. Aus der Leibesmitte können physiognomische Energien aufbrechen, Hebungen und Senkungen, Buckelungen und Höhlungen. Indem Förster den Bewegungsspielraum seines Kleist-Torsos so weit wie möglich begrenzt, ihn zum wahrhaften Stand-Bild einengt, die Arme, den Rumpf preisgibt und diesen mit den Beinen zu einer durchlaufenden Senkrechten vereinigt, revoltiert bei ihm die Gebärde gegen die beharrenden, lotrechten Formabsprachen, gegen die Mitte des Leibes, gegen das sicher Umgrenzte, gegen die maßvoll abgestumpfte Form. Dieser Aufruhr trägt schließlich den Sieg davon.
Das skulpturale Gebilde greift inbrünstig in den Raum, wird Metapher einer Sehnsucht des Menschen, deren Preis die Verletzung, deren Triumph die dionysische Ekstase ist. Darum auch die Beziehung der Figuren Försters zu den mythischen Gestalten, in denen das Erlebnis von Sturz und Scheitern, Abbruch und jäher, schmerzhafter Wendung aufbewahrt ist: Dädalus, Ikarus, Orpheus, aber auch Penthesilea.
Kleist ging wie Penthesilea in seiner gleichnamigen Tragödie sozusagen „an der Wirklichkeit vorbei“. Jenes „Hic Rhodus, hic salta!“ (hier musst du handeln, dich entscheiden), das ihm Goethe in seinem Brief vom 1. Februar 1808 zurief, hat er sich nicht zu eigen machen können. „Das Leben, mit seinen zudringlichen, immer wiederkehrenden Ansprüchen, reißt zwei Gemüter schon in dem Augenblick der Berührung so vielfach auseinander, um wieviel mehr, wenn sie getrennt sind. An ein Näherrücken ist gar nicht zu denken; und alles, was man gewinnen kann, ist, dass man auf dem Punkt bleibt, wo man ist“, schreibt er verbittert 1811 an Marie von Kleist. Er, seine Penthesilea und auch sein Kohlhaas standen unter einem anderen Lebensgesetz. Der Riss, der durch sie hindurchgeht, der Widerspruch, dem keine Versöhnung beschieden ist – er ist auch in uns. Kleist hat es uns vorgelebt. In der Tat: Er hat den Stachel nicht aus unserem Fleische gezogen.
Schauen wir sie uns an, Försters Skulptur für Heinrich von Kleist (1976/77, Sandstein), sie steht im Chor der Marienkirche zu Frankfurt/Oder und zieht magisch die Blicke auf sich.
Am 12. Februar begeht der Bildhauer, Zeichner, Grafiker und Schriftsteller Wieland Förster seinen 95. Geburtstag.