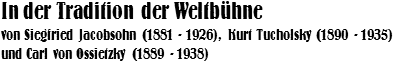Martin Schulz war einst der mächtigste Sozialdemokrat im EU-Parlament. Bis er sich 2017 von dem damaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel – der selbst keine Lust hatte, gegen Angela Merkel eine Bundestagswahl zu verlieren – beschwatzen ließ, Kanzlerkandidat zu werden. Dafür durfte er zugleich den Parteivorsitz übernehmen und erhielt als einziger Vorsitzender denn je 100 Prozent der Parteitagsstimmen. Anschließend war er der vierte erfolglose SPD-Kanzlerkandidat gegen Merkel und verschwand glücklos aus dem Parteivorsitz. Jetzt ist er Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Als solcher durfte er in dem in Rede stehenden Buch ein knappes Vorwort schreiben.
Darin erklärt er, die Zukunft werde „zunehmend als Bedrohung, nicht als Versprechen wahrgenommen“. Allgemeiner kann man die Inhaltsleere derzeitiger sozialdemokratischer Programmatik kaum umschreiben. „Multiple Krisen und die Transformation setzen die Gesellschaft unter Anpassungsdruck.“ Was hier „die Transformation“ sein soll, bleibt unklar. Meint er die Explosion der Energiepreise für die Kleinverbraucher oder Habecks Heizungsrestriktionen? Die können kaum als sozialdemokratisches Zukunftsversprechen durchgehen. Folgerung: „Der Ruf nach einem starken und gestaltenden Staat wird lauter.“ Niemand glaube mehr „an die Idee eines neoliberal schlanken Staates“. Gebraucht werde ein moderner und handlungsfähiger Staat. Dessen Leitmotivik „aus progressiver Sicht“ werde in diesem Band behandelt.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte gemeinsam mit dem politikwissenschaftlichen Institut der Universität Bonn im Wintersemester 2022/2023 eine Ringvorlesung zum Thema des modernen Staates veranstaltet. Die 15 Beiträge von 22 Autoren wurden in diesem Band versammelt. Die Themenfelder sind naturgemäß sehr breit angelegt. Der Staat brauche „nicht weniger, sondern innovativere Bürokratie“. Die Verwaltung solle sich weniger auf Beratungsunternehmen stützen, sondern müsse „ihr internes Know-how wieder aufbauen“. Die Digitalisierung berge die „Gefahr des ‚schleichenden Blackouts‘ für unsere Demokratie“. Die Staatsaufgaben müssten stärker darauf gerichtet sein, der Mensch-Natur-Krise zu begegnen. Es brauche ein „Klimamainstreaming aller Politikbereiche“, aber zugleich ein soziales und partizipatives Staatshandeln. Die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer fordert „gleichstellungsorientierte Demokratie- und Staatskonzepte“, der Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum eine „neue europäische Industriepolitik“, um den Entwicklungen in China und den USA begegnen zu können. Der Verwaltungsrechtler Tristan Barczak plädiert für den Übergang des in der Pandemie „nervösen“ Staates „zum resilienten Staat“. Es brauche „Resilienz als Rechtskonzept“, einen angemessenen „Ausgleich von Freiheit und Sicherheit in Krisenzeiten“, der auch einen schonende wie zeitgemäße „Fortschreibung des Ausnahmeverfassungsrechts“ einschließen müsse. Zu den Arbeitsschwerpunkten des Mannes gehören Sicherheitsrecht, Polizeirecht und das „Recht der Nachrichtendienste“.
Der Beitrag von Gesine Schwan ist überschrieben mit „Brandt und der demokratische Staat“. Sie bezieht sich auf einen Satz von Willy Brandt: „Für den Weltfrieden ist Solidarität zwischen Nord und Süd zentral.“ Der Ukrainekrieg habe „uns drastisch unsere Abhängigkeit nicht nur von russischem Gas, sondern auch von der Solidarität der Staaten und Menschen in Afrika, Asien, Nord- und Südamerika“ vor Augen geführt. Ohne sie werde es nicht gelingen, „Putin einzudämmen“. In Deutschland sei gedacht worden, „dass wir die anderen nicht brauchen“. „Nur durch Einbettung in eine überzeugt demokratische Europäische Union und in freiwilliger Solidarität und Kooperation mit demokratischen Verbündeten weltweit haben wir Chancen für einen demokratischen nationalen Staat auch im Innern.“ Sie spricht sich zwar gegen einen „exklusiven Klub“ der Demokratien aus, will aber „für die demokratische Idee werben“. Der Begriff der friedlichen Koexistenz als Kern einer wirklichen Friedenspolitik im Sinne Brandts kommt bei ihr nicht vor.
Während die meisten Beiträge von mehr oder weniger bekannten Gelehrten stammen, ist der Text zur Außen- und Sicherheitspolitik ein Eigenprodukt der Friedrich-Ebert-Stiftung: Christos Katsioulis leitet das Stiftungsbüro „für Zusammenarbeit und Frieden“ in Wien, Peer Teschendorf koordiniert „das Stiftungsprojekt zur Zeitenwende“, soll also den Ankündigungen des Kanzlers zur Zeitenwende einen theoriegeleiteten Untersatz liefern. Der ist im Unterschied zu vielen der gesellschaftspolitischen Texte von erfrischender Deutlichkeit.
Die derzeitige Weltlage wird als „neue Unordnung“ beschrieben. Zu den Veränderungen zählen die Autoren den „Arabischen Frühling“, die Annexion der Krim durch Russland und die Intervention im Donbass, den Krieg in Syrien und die darauffolgende Flüchtlingsbewegung nach Europa, schließlich das erneute „Aufflammen des Eroberungskriegs Russlands“. Die Rückkehr eines großen Krieges in Europa und „die Debatte über die Möglichkeit einer nuklear geführten Auseinandersetzung“ seien Symptome größerer Veränderungen im außenpolitischen Umfeld Deutschlands. Der globale Schwerpunkt verschiebt sich nach Asien, China ist aktiver Akteur auf der globalen Ebene, die USA „verlieren an Gestaltungsmacht“. Da der Westen den Ländern des Südens gegenüber „häufig mit Auflagen hinsichtlich Werten“ daherkommt, China und Russland jedoch derartige Forderungen nicht stellen, haben diese Länder größere außenpolitische Wahlmöglichkeiten. Hinzu kommen der Klimawandel, Künstliche Intelligenz und andere Weltprobleme.
Die Herausforderungen für Außen- und Sicherheitspolitik sind größer geworden. „Zwischen der Notwendigkeit zu handeln und der Fähigkeit, Entwicklungen direkt zu beeinflussen, klafft eine immer größere Lücke.“ Dabei seien die Erwartungen „an die Handlungsfähigkeit Deutschlands in Krisen und die Übernahme von Führungsfunktionen“ gewachsen. Auch wenn zum Thema Sicherheitspolitik „die Nachrüstung der Bundeswehr“ zur konventionellen Landes- und Bündnisverteidigung im Mittelpunkt stehe, seien die sicherheitspolitischen Herausforderungen wesentlich komplexer. In Sachen Außenpolitik gehe es um die „Reduktion von Verwundbarkeiten“ gegenüber äußeren Einflüssen. Deutschland habe „ein hohes Interesse daran, globale diversifizierte und belastbare Beziehungen zu pflegen, bei Krisen und Konflikten glaubhaft vermitteln und bei Bedarf auch eigenständig handeln zu können.“ Diesen Satz kann man als Kritik an der derzeitigen Außenpolitik lesen; in Bezug auf den Ukraine- und den Gaza-Krieg hat sich Deutschland diese Möglichkeit selbst verbaut.
Es folgen weitere, bemerkenswert kritische Anmerkungen. Deutschland müsse es „nachholen“, seine eigenen Interessen klar zu formulieren, sie klar zu priorisieren und strategisch zu verfolgen. Dazu müssten „zunächst die Kapazitäten für Analyse und Planung verbessert werden“ und die Arbeitsweise „in Richtung Prognosefähigkeit verbessert werden“, einschließlich der „Entwicklung von Szenarien“. Eine solche Akzentverschiebung würde die Rolle des Auswärtigen Amtes stärken. „Die Fähigkeit, in den verschiedenen Ländern der Welt Informationen zu analysieren und Entwicklungen zu erkennen, wird künftig von wachsender Bedeutung sein. Dies ist die Grundlage einer verbesserten Kommunikationsfähigkeit mit Partnern weltweit. Wenn es gelingen soll, in wechselnden Konstellationen Kooperationen zu vereinbaren, in Konflikten zu vermitteln und Projekte zu stemmen, müssen Partner besser verstanden werden und es uns jederzeit möglich sein, mit ihnen erfolgreich zu kommunizieren.“
Wer gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen, wie viele einst in der DDR, versteht hier: Das realexistierende Auswärtige Amt mit der derzeitigen Ministerin an der Spitze vermag dies alles nicht hinreichend. Klarer kann man das SPD-seitig nicht formulieren, ohne einen Koalitionskrach anzuzetteln.
Thomas Hartmann-Cwiertnia, Jochen Dahm, Frank Decker (Herausgeber): Der moderne Staat. Was er ist, was er braucht, was er kann. Verlag J.H.W. Nachf., Bonn 2023, 208 Seiten, 16 Euro.