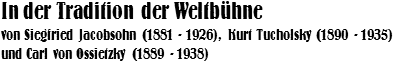Diesmal: „Schwarzer Block“ Gorki-Theater, „Gott“ Berliner Ensemble, „Melissa kriegt alles“ Deutsches Theater.
***
Sie mögen rührend sein, wenn sie mit hellsichtiger Wut und sämtlichen Fingern auf die Wunden dieser Welt weisen. Doch sie werden zu Ungeheuern, wenn sie in irrsinnigem Wahn mit den Fäusten drauflos schlagen, um die Welt zu heilen. – Sie, das sind die besessenen jungen Leute mit den Kapuzenpullovern, die mit dem Schrei nach Gerechtigkeit das Recht abfackeln. Die Autonomen, die sich links nennen ohne zu kapieren, wie ihr Extremismus sie nach rechts treibt. Sie sind die Antifa, für die alle anderen die Nazis sind. Ihr „Polit-Programm“ heißt Umsturz (Staat, Gesetz, Gesellschaft). Und ihre „Partei“ heißt Schwarzer Block.
Das Gorki-Theater, mit seinen Themen stets und innovativ am irritierend wild schlagenden Puls der Zeit, lässt diese Minderheit jetzt zu Wort kommen: In einer Art Collage von Kevin Rittberger, in dessen Text poetische Dichte und propagandistische Ansage sich kreuzen. Knallender Titel: „Schwarzer Block“.
Das ist mutig, wichtig und – ja auch bewundernswert. Es ist wohl das erste Mal, dass Sprache und Wollen des Schwarzen Blocks derart dezidiert auf einer Bühne laut werden. Der Erkenntnisgewinn ist für uns, die mehrheitlich (geschockt) beiseite stehen und im einschlägigen Jargon kurz und pauschal für Faschos gehalten werden, beträchtlich. Für die „Aktivisten“ selbst, sofern sie überhaupt ins „feindlich-bürgerliche“ Theater kommen, ist es womöglich eine Bestätigung. Dieses Risiko ist die Theaterleitung eingegangen. Dafür Dank.
Der Autor, der mehr als ein Jahr lang in der Szene wie in der Anarcho-Historie recherchiert hat (vom Jetzt zurück bis ins 19. Jahrhundert, doch nicht bis hin zu Schillers „Räubern“), liefert eine frappierend sprachwuchtige Innenschau vom schwarzen Antifa-Block.
Und Regisseur Sebastian Nübling präsentiert sie mit gezielt überbordender Phantasie, spektakulär arrangierten Gruppen- und Einzelaktionen als ein man darf sagen grandioses Oratorium. Gemeinsam mit einer Truppe von 14 starken Performern sowie einem faszinierenden, extrem aufwändigen, bis dato derart sinnvoll noch nicht erlebten Einsatz von Film, Ton und Musik. Doch hier ist Hi-Tech nie Selbstzweck, sondern dient suggestiver Theatralik. Ja, es ist ein Akt massiver Überwältigung. Ein fürchterliches Monument des Extremen. Ein schreiendes Warnbild ganz in schwarz. Und: Ein im Wortsinn tolles Gesamtkunstwerk.
Der Schwarze Block mag mit seiner Weltsicht das Schwarze treffen und unsereins herausfordern zur Selbstbefragung. Doch zugleich führt er ins Ausweglose. Ins alles Zerstörende. Das ist die Botschaft des packenden Abends. Schwer zu ertragen.
***
Mal herhören: „Gott“ von Ferdinand von Schirach ist kein Drama, hat keine Handlung, keine Figuren, ist kein Theaterstück und könnte gut auch in der Urania oder einer Zentrale für politische Bildung stattfinden. Trotzdem bewegt und polarisiert seit der Uraufführung im Berliner Ensemble ein gebanntes Publikum: Massenandrang beim Ticket-Verkauf.
Der vom Intendanten Oliver Reese uraufgeführte Text ist eine Art Forum zum Thema Sterbehilfe. Und genau dieses Thema elektrisiert die Massen; nämlich die Frage nach der Legitimität und der möglichen Legalisierung des ärztlich assistierten Suizids. Eine Frage, auf die es auch bei Schirach keine allseits befriedigende Antwort gibt, geben kann.
Vielmehr existiert eine Vielzahl durchaus plausibler Antworten – juristische, ethische, religiöse, individuelle, die der Autor ausführlich auflistet in seinem Thesentext. Bei dessen immerhin spannender Verlautbarung die Ausschüttung eines Füllhorns theaterästhetischer Mittel zu erwarten, ist müßig und geradezu verstiegen. Das braucht es hier nicht.
Das Setting auf karger Bühnentreppe ist eine fiktive Sitzung des Deutschen Ethikrats. Diskutiert wird der wohlüberlegte, mit den erwachsenen Kindern und Ärzten besprochene dringende Wunsch einer 78 Jahre alten Frau, nicht mehr allein weiterleben zu wollen nach dem schweren Tod ihres Mannes an einem grauenvollen Hirntumor. Die ehemalige Architektin, ärztlich attestiert gesund in jeder Hinsicht, möchte so sterben, wie sie erfüllt und glücklich gelebt hat in 42 Ehejahren. Also in Würde, an einem Medikament. Und nicht am Strick oder auf Bahngleisen vor einem Zug.
Die vom rhetorisch versierten Ensemble verhandelten Diskurs-Punkte drehen sich um Freiheit und Selbstbestimmung; also um die letztlich nicht eindeutig zu lösende Frage: Wem gehört das Leben und mithin der Tod – dem Staat (Gesetzgeber), einer Ideologie (Moral, Religion)? Hat der Wunsch zu sterben mit Egoismus, Unmoral oder etwa doch mit Krankheit (Depression) zu tun?
Die ärztliche Sterbehilfe wurde – auf höchst unbefriedigende Weise ‑ juristisch neu geregelt mit dem Paragraphen 217 des Gesetzes von 2015. Zwei Jahre später erklärte das Bundesverfassungsgericht 217 für verfassungswidrig; ärztliche Suizidassistenz wurde legal, freilich gebunden an die Selbstbestimmtheit des Todeswunsches. Was wiederum für die betreffende Person, die Behörden, die Ärzte zu beweisen nicht einfach ist. Die entscheidenden Fragen bleiben theoretisch wie praktisch weiterhin offen.
Keine schlechte „Lösung“ für das Theater, das hier im klassischen Sinn als Agora funktioniert, die vehement angenommen wird – erregte Zwischenrufe aus dem Publikum. Was will man mehr vom Theater …
***
Wer ist Melissa, wo lebt sie und wie? Und warum bekommt sie immer alles? Aber was ist „alles“? Steckt sie womöglich in Corona-Quarantäne fest und wird privilegiert beliefert mit eben allem; etwa von Amazon oder Lieferando.de?
In seinem neuesten Plauderstück „Melissa kriegt alles“, das René Pollesch in Windeseile zusammengeschrieben hat, kommt Pandemie nicht vor. Kein Gedanke ans Nächstliegende, hochtrabend gesagt: an gesellschaftlich Relevantes – wie sich’s doch gehört hätte fürs heftig angesagte Pollesch-Diskurstheater.
Also was dann für Gedanken im Neunzig-Minuten-Geplapper von Kathrin Angerer, Franz Beil, Jeremy Mockridge, Bernd Moss, Katrin Wichmann und Martin Wuttke, die sich abrackern in einer niedlichen Puppenstuben-Datscha mit Hammer-und-Sichel-Tapete. Im Programmheftchen stehen auf der letzten Seite kleingedruckt die Quellen, woraus der Autor schöpfte: Bini Adamczak „Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende“; Alexandra Kollontai „Wege der Liebe“; Boris Groys und Carl Hegemann „Metanoia. Die Kunst als unbewegter Beweger oder die Welt als ewige Ruhestätte“; Barbara Kirchner zu Alexandra Kollontai „Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin“; der Woody-Allen-Film „Schmalspurganoven“ sowie Lorene Scafaria „Hustlers“, ein Film über Stripperinnen.
Es könnte sich also im russischen Puppenheim um Folgendes drehen: Um Bewegung und Ruhe, Hingabe und Selbstbehauptung, ums Ich und das Wir (oder die Partei oder so). Oder gar um das ewige Stirb und Werde und noch dazu um all das zugleich. Alt-Autoren inspirierte solch Dialektik-Salat zu hochdramatischen Exzessen. Doch bei Pollesch bleibt alles abstrakt bequasseltes Zeug. So irgendwie. – Hätte man die Bücher gelesen, die Filme gesehen haben müssen, damit Pollesch-Aufklärung funktioniert?
Wir Dämels haben also selbst schuld. Zum gnädigen Ausgleich spendiert der hochmögende Autor und designierte Volksbühnen-Chef die seltsam volkstümlich gemeinte Belustigung über ein Gefasel vom Brecht-Theater als eins der Trance sowie über performative Theorien, die niemanden erregen außer die performenden Aktivisten (und Innen) selbst.
Mehrheitlich interessant hingegen mag das Heulen von Hartz-IV-Leuten sein, die Bio-Eier wollen, das Geld nicht haben und deshalb – wie in Trance – bei Aldi zu Ja-Eiern greifen. Da hätten wir wenigstens ein (!) allgemein relevantes Thema. Ansonsten bleibt alles beim hingebungsvollen Tröten in der meta-mäßig aufgepumpten Pollesch-Blase. Würde die mal platzen, wäre das ein Knaller in Polleschs elitär dahin raunender, ätzend sich breit wälzender Dauer-Langeweile.