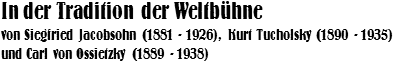Es gibt nichts Neues unter der Sonne
Opel, so ist vor einigen Tagen bekannt geworden, hat bislang jedem seiner Betriebsräte monatlich einen finanziellen Zuschlag zwischen 300 und 1.500 Euro gezahlt. Selbstverständlich ist das kein Verstoß gegen das gesetzliche Gebot, dass Betriebsratsarbeit – aus dem guten Grund der Unabhängigkeit – unentgeltlich sein soll, versteht sich. Von faktischer Bestechung kann überhaupt keine Rede sein, doch nicht in deutschen Unternehmenslanden. Lediglich Überstunden sollten so abgegolten werden, na klar doch. Merkwürdig, warum mir dazu der folgende Text von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1931 einfällt – vielleicht ja, weil es wieder mal bestätigt: Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Heinz W. Konrad
Die Verräter
Na, Verräter eigentlich nicht. Ein Verräter, das ist doch ein Mann, der hingeht und seine Freunde dem Gegner ausliefert, sei es, indem er dort Geheimnisse ausplaudert, Verstecke aufzeigt, Losungsworte preisgibt… und das alles bewußt… nein, Verräter sind diese da nicht. Die Wirkung aber ist so, als seien sie welche, doch sind sie anders, ganz anders.
Da wird man vom Vertrauen der Parteigenossen ausgesandt, mit dem bösen Feind zu unterhandeln, sozusagen die Arbeiter zu vertreten, die ja inzwischen weiterarbeiten müssen. Und die erste Zeit geht das auch ganz gut. Geld… ach, Geld… wenn die Welt so einfach wäre. Geld ist zunächst gar nicht zu holen. Der Arbeiterführer bleibt Arbeiterführer; leicht gemieden von den Arbeitgebern, merkwürdiges Wort, übrigens. Nein, nein, man bleibt ein aufrechter Mann.
Aber im Laufe der Jahre, nicht wahr, da sind so die langen Stunden der gemeinschaftlichen Verhandlungen an den langen Tischen: man kennt einander, die Gemeinsamkeit des Klatsches eint, und es wird ja überall so viel geklatscht. Nun, und da stellt sich so eine Art vertraulicher Feindschaft heraus.
Kitt ist eine Sache, die bindet nicht nur; sie hält auch die Steine auseinander. Zehn Jahre Gewerkschaftsführer; zehn Jahre Reichstagsabgeordneter; zehn Jahre Betriebsratsvorsitzender – das wird dann fast ein Beruf. Man bewirkt etwas. Man erreicht dies und jenes. Man bildet sich ein, noch mehr zu verhüten. Und man kommt mit den Herren Feinden ganz gut aus, und eines Tages sind es eigentlich gar keine Feinde mehr. Nein. Ganz leise geht das, unmerklich. Bis jener Satz fällt, der ganze Reihen voller Arbeiterführer dahingemäht hat, dieser infame, kleine Satz: „Ich wende mich an Sie, lieber Brennecke, weil Sie der einzige sind, mit dem man zusammenarbeiten kann. Wir stehen in verschiedenen Lagern – aber Sie sind und bleiben ein objektiver Mann…“ Da steckt die kleine gelbe Blume des Verrats ihr Köpfchen aus dem Gras – hier, an dieser Stelle und in dieser Stunde. Da beginnt es.
Der kleine Finger ist schon drüben; der Rest läßt nicht mehr lange auf sich warten, „Genossen“, sagt der Geschmeichelte, „man muß die Lage von zwei Seiten ansehn …“ Aber die Genossen verstehen nicht recht und murren: sie sehn die Lage nur von einer Seite an, nämlich von der Hungerseite. Und was alles Geld der Welt nicht bewirkt hätte, das bewirkt jene perfide, kleine Spekulation auf die Eitelkeit des Menschen: er kann doch die vertrauensvollen Erwartungen des Feindes nicht enttäuschen. Wie? Plötzlich hingehn und sagen: Ja, die Kollegen billigen das nicht, Krieg muß zwischen uns sein, Krieg und Kampf der Klassen, weil wir uns ausgebeutet fühlen…? Unmöglich. Man kann das unmöglich sagen. Es ist zu spät.
Und dann geht es ganz schnell bergab. Dann können es Einladungen sein oder Posten, aber sie müssen es nicht sein – die schlimmsten Verräterein auf dieser Welt werden gratis begangen. Dann wird man Oberpräsident, Minister, Vizekönig oder Polizeipräfekt – das geht dann ganz schnell. Und nun ist man auch den grollenden Zurückgebliebenen, die man einmal vertreten hat und nun bloß noch tritt, so entfremdet – sie verstehen nichts von Realpolitik, die Armen. Nun sitzt er oben, gehört beinah ganz zu jenen, und nur dieses kleine Restchen, dass sie ihn eben doch nicht so ganz zu den Ihren zählen wollen, das schmerzt ihn. Aber sonst ist er gesund und munter, danke der Nachfrage.
Und ist höchst erstaunt, wenn man ihn einen Verräter schilt, Verräter? Er hat doch nichts verraten! Nichts – nur sich selbst und eine Klasse, die zähneknirschend dieselben Erfahrungen mit einem neuen beginnt.
Ignaz Wrobel, Aus: Die Weltbühne, 45/1931
Alter
von Margit van Ham
Für Elisabeth Schulz-Semrau zum 80.
Ein Zelt aus Schatten
hat der Baum um sich
geworfen, Arena für
den Lichttanz seiner Blätter.
Ruhe, leises Rauschen.
Zeitloses. Schönheit.
Alter.
Im Gesicht der Schmerz
vergraben. Alter
wirft seine Schatten aus.
Ein Lächeln aber
geht darin spazieren.
Ist zeitlos.
Und schön.
Prellbock auf Brandenburgs Weg zum Sozialismus
Als jemand, der sein Studium, zumal noch eines der Betriebswirtschaft , altersbedingt erst 1989 beendet hat und somit gnädig spätgeboren einer beruflichen Einbindung in die sozialistische Planwirtschaft entkommen konnte, darf die Karriere von Saskia Ludwig zur heutigen Landes- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Brandenburg gewiss als unbefleckt gelten. Das Zusammengehen lupenreiner Demokratieerfahrungen mit intellektueller Investigativität gebiert zudem Geistesleistungen, die die Prädestination der mit 42 Jahren noch immer jung zu nennenden Frau für ein so beachtliches politisches Führungsamt anschaulich unterstreichen. Immerhin hat Saskia Ludwig mit analytischer Akribie ein Komplott aufgedeckt, das durchaus in die Kategorie der Super-GAUs gehört und nun im letzten Moment verhindert werden konnte: „Die letzte linke Regierung in Deutschland will zurück zum Sozialismus. Die schleichenden Vorboten dieser Ideologie spüren wir tagtäglich in unserer Arbeit als Opposition.“ Wow!
Wie prämortal es um Brandenburgs Demokratie und Marktwirtschaft dank der Platzeck-Regierung steht, hat Frau Ludwig per Interview übrigens auch der Jungen Freiheit enthüllt: „Korruption, Filz und Vetternwirtschaft“ habe die seit 21 Jahren ununterbrochen in Brandenburg regierende Stolpe-/Platzeck-SPD ermöglicht, wird sie dort zitiert. Ehemalige Stasi-Leute hätten in einigen Fällen noch immer führende Positionen an Universitäten, Gerichten und Staatsanwaltschaften inne. Gut, dass das mal jemand so schonungslos sagt.
Von der Berliner Zeitung darauf hingewiesen, dass die Junge Freiheit die öffentliche Reaktion auf die Neonazi-Morde einen „Chor der Selbstgerechten“ nennt, dem es um „Ablenkungsmanöver von der drohenden Finanzkrise“ ginge, wird die Brandenburgische CDU-Chefin gefragt, ob sie „in einer Zeitung, die so etwas angesichts von Rechtsterrorismus schreibt, nochmals publizieren“ würde. Ihre Antwort: „Um das klarzustellen, ich verurteile diese Morde, so wie im Übrigen alle Gewaltverbrechen, aufs Allerschärfste. Ein Interview würde ich geben, schon alleine aus Respekt vor der Presse- und Meinungsfreiheit in unserer Demokratie.“ – Respekt vor so viel Respekt. Damit wird es Frau Ludwig noch weit bringen, wetten dass …?
Rüdiger Landsmann
Mörderkarrieren
Mit der „Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten“ existiert ein bemerkenswertes Editionsprojekt in Sachen Mordtopographie des Nazi-Reiches. Die Historikerin Andrea Riedle, sie ist Assistentin der Ständigen Konferenz der Leiter der NS-Gedenkorte im Berliner Raum, veröffentlichte im Sommer den Band 31 dieser Reihe, eine Untersuchung über die Angehörigen des Kommandanturstabes des KZ Sachsenhausen. Eine verdienstvolle Publikation, die Autorin räumt mit verfestigten Legenden auf. Explizit stellt sie sich der Frage, ob es sich hinsichtlich der Sozialstruktur bei der Herkunft dieser Berufsmörder und ihrer „Karrierewege“ tatsächlich um „sozial Deklassierte“ oder „Minderbegabte aller Art“, wie es seinerzeit Eugen Kogon („Der SS-Staat“) postulierte, handelte und deren Gründe zum Beitritt in die SS-Totenkopf-Verbände mithin banaler Natur gewesen seien. Riedle weist nach, dass die Biografien dieser Männer einer starken politisch-ideologischen Determinierung unterlagen, das Erleben von sozialer Ausgrenzung zum Beispiel im Gefolge von Demilitarisierung nach dem Ersten Weltkrieg oder der Weltwirtschaftskrise der Endzwanziger Jahre nicht ohne Einfluss auf deren Lebensweg, aber eher katalytischer Natur war. Auch Exzesstäter mit stark sadistischer Prägung wie der berüchtigte Gustav Sorge – Andrea Riedle untersetzt den analytischen Teil ihres Buches mit vier exemplarischen biographischen Studien zu SS-Unterführern des KZ-Sachsenhausen mit durchaus unterschiedlicher psychischer Grundstruktur – waren nationalsozialistische Überzeugungstäter. Mit dem statistischen Nachweis, dass die Grenzen zwischen den Totenkopf-Einheiten und der so genannten „kämpfenden“ Truppe der SS seitens der Reichsführung SS absichtsvoll fließend gehalten wurden, tritt sie der nicht nur in neofaschistischen Kreisen gern gepflegten Legende von der „anderen“ SS entgegen. Der SS-Führung war daran gelegen, einen einheitlichen Korpus zu schmieden, der sich gegenüber der sonstigen nationalsozialistischen „Umwelt“ durch ein dezidiertes Elitedenken und -verhalten abhob. Die Angehörigen dieser Truppe sollten sich eben nicht als „ganz normale Männer“ empfinden, um Christopher R. Brownings berühmte Untersuchung über das Reserve-Polizeibataillon 101 zu zitieren. Und sie empfanden sich auch nicht so. Dass die Wirklichkeit dem SS-Führungsideal der „anständigen Mördertruppe“ mitnichten entsprach, wird von der Autorin belegt. Andrea Riedles Studie positioniert sich deutlich gegen die immer wieder auftauchenden Versuche einer simplifizierenden Betrachtung der faschistischen Terroreinheiten. Dies impliziert mithin die Ermahnung, bei der Auseinandersetzung mit (wieso eigentlich neo-?) faschistischen Strukturen sich zu einfacher Erklärungsmuster zu bedienen. Auch die Nachfahren – das ist nicht familiär gemeint! – dieser Leute versuchen sukzessive Elitestrukturen zu entwickeln, die nicht zu unterschätzen sind.
W. Brauer
Andrea Riedle: Die Angehörigen des Kommandanturstabs im KZ Sachsenhausen. Sozialstruktur, Karrierewege und biografische Studien, Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Band 31, Metropol Verlag, Berlin 2011, 284 Seiten, 22,- Euro (in der Gedenkstätte Sachsenhausen 13,20 Euro)
Eine einfache Zeit
Zwei Jungs sitzen gemeinsam einsam in ihrem Zimmer, der eine blättert im väterlichen Spiegel, der andere wirft einige Skizzen auf ein Paar Servietten. Der Lesende macht den Zeichnenden auf einen Artikel im Heft aufmerksam: „Guck mal, das ist Bin Laden, der ist voll einflussreich in der arabischen Welt. Einst wird er uns alle beherrschen! Was rede ich da eigentlich? Naja, jedenfalls ist der voll mächtig.” Die Informationen fließen spärlich, aber dieser Name klingt so gut, dass er sich einprägt. Beide malen sich aus, was man damit tun könnte, denken hin und her und steigern ihre Ideen ins unermessliche – was er tun wird, was sie tun werden, wenn er es tut. Sie recherchieren täglich, stoßen auf das Internet, finden immer dieselben Informationen. Die Alten schauen nur drauf und schütteln den Kopf: „Wer soll das sein? Überhaupt, Internet – Mechanik, das war noch was, das konnte man noch selbst reparieren. Ihr wisst doch nicht einmal wie euer Internet funktioniert.” Die Jungs ließen sich nicht beirren, eines Tages entwarfen sie gemeinsam ein Logo mit dem Namen dieses seltsamen Mannes. Beide lächelten, ein Plan gärte in ihren Schädeln: Bin Laden Street Waer – ein eigenes Modelabel zu Ehren des Mannes, der bald alles beherrschen sollte. Voller Eifer stürzten sie sich in die Arbeit, machten Skizzen, erzählten ihren Freunden davon und propagierten diesen Namen. Irgendwann erlahmte ihr Eifer, das Interessante ward verschwunden, das erste, zweite etc. Bier wurde getrunken, sie trafen sich mit Mädchen und lasen immer öfter das väterliche Magazin. Bis eines Montags das Motiv des anbrechenden Jahrtausends auf dem Cover erschien, sie wussten bereits bescheid, ließen sich nochmals alles bestätigten, die Informationen flossen zahlreich, die Hintergründe wurden klarer. Flugzeuge gingen ab nach Afghanistan, sie sahen den Film und lasen das Buch eines dicken kurzatmigen Amerikaners, die Fortsetzungen ebenfalls – immer das gleiche in Variationen. Rom wollte in Mesopotamien einmarschieren, sie gingen mit der Schule demonstrieren. Die Skizzen lagen währenddessen in der Schublade. Hin und wieder verschwendeten sie einen Gedanken daran, ein leicht verschämtes Erinnerst-Du-Dich-Noch erschien in den nächtlichen Gesprächen, kein Lachen mehr – nicht mehr zwischen Atombombe und permanenter Sicherheit.
Zurück in die verlorene Zukunft.
Paul
La Constancia